Dein Warenkorb ist gerade leer!

Table of Contents
Das Universum des Moíra-Zyklus
Im Verlauf der ersten beiden Bände dieser Geschichte haben unsere Protagonisten festgestellt, dass unser Universum einige kleine, aber wichtige Eigenschaften aufweist, die sich nicht mehr mit den derzeit gültigen Theorien beschreiben lassen. So hat Professor Walter Stein aus Paris im kosmischen Mikrowellenhintergrund, der den sichtbaren Teil unserer Welt umgibt, ein aufmoduliertes Signal entdeckt, das von ‘außerhalb’ unseres Universums kommen muss und – digital aufbereitet – einen bildhaften Eindruck davon vermittelt, wie es dort ‘draußen’ aussehen könnte.
Unglücklicherweise sind diese Informationen nicht dreidimensional. Menschen, die das daraus errechnete ‘O’Connor Panorama’ betrachten und zu verstehen versuchen, verlieren sich in albtraumhaften Details, die für menschliche Gehirne unverständlich sind, sich in die eigenen Erinnerungen fressen und sie verändern. Es gibt dabei einen Zusammenhang mit einer Anomalie, die 2016 im CERN Institut in der Nähe von Genf bei einem fehlgeschlagenen Experiment im Hauptbeschleuniger entstanden ist. Empfindliche Personen im Kanton Genf erlebten durch sie zeitweilig ähnliche Symptome.
Die Anomalie bildet eine Dimensionspforte und führt in ein Paralleluniversum, das durch die Schwerkraft an unser eigenes gebunden ist und in dem alles aus Antimaterie besteht. Diese kann jederzeit in unsere Welt sickern und bildet eine ständige Gefahr.
Glücklicherweise ist das nicht allgemein bekannt. Niemand hat Interesse daran, eine Massenpanik anzuheizen. Außer den vor Ort beteiligten Wissenschaftlern und Professor Stein weiß lediglich das Team des Pariser Journalisten Mike Peters davon. Er ist dem Phänomen bereits 2016 durch hartnäckige Recherchen auf die Spur gekommen und gehört zu dem kleinen Personenkreis, der das O’Connor Panorama selbst betrachtet hat. Auch der wissenschaftliche Geheimbund Moíra, in dem Professor Stein Mitglied ist, wurde unterrichtet und hat in der Vergangenheit bereits Feuerwehr gespielt.
Problematischer gestaltet sich die Mitwisserschaft eines aus Russland gesteuerten Unternehmenskonsortiums. Sie versuchen, aus den der Erscheinung zugrunde liegenden wissenschaftlichen Erkenntnissen Kapital zu schlagen. Nach einer fehlgeschlagenen Einmischung in das Geschehen am CERN im vergangenen Jahr herrscht allerdings Ruhe …
Neutronenreiter – Prolog (22.12.2017)
Professor Walter Stein saß zusammengesunken in seinem Rollstuhl. Bei seinen letzten Aufenthalten in der Kolonie hatte ihm noch ein schlichter, hölzerner Liegestuhl genügt, doch mittlerweile fühlte er sich zu schwach, um aus eigener Kraft aufzustehen. Seine früher so wachen und interessierten Augen lagen tief in den Höhlen. Wer ihn heute sah, mochte nicht glauben, dass dieser Mann einmal ganze Hörsäle in seinen Bann gezogen hatte.
Die Luft flimmerte jetzt am Mittag vor Hitze, aber Walters Stuhl befand sich im lichten Schatten einer Araukarie vor der meisten Sonne geschützt. Auf dem Tischchen neben ihm lag ein Buch aufgeschlagen auf dem Gesicht. Auf dessen Rücken stand der Name des Autors: Isaac Asimov. Walter hatte den Rest Kaffee in dem Becher daneben schon eine Weile nicht mehr angerührt. Trotz der Wärme hatte er seine Decke bis unters Kinn gezogen. Nur seine knochigen Hände lagen unbedeckt auf den Stuhllehnen. Über sie spannte sich dunkle Haut dünn wie Pergament.
»Hallo Walter, wir haben Besuch.«
Er schreckte aus seinem Dämmerzustand hoch und sah zwei Frauen vor sich stehen. Er mußte die Augen zusammenkneifen, um sie erkennen zu können.
»Klotho, ich freue mich, dass du mir ein wenig Gesellschaft leistest! Mein Betreuer hat mich vorhin auf diesen Platz geschoben und es für mich gemütlich gemacht.«
»Dies ist einer der schönsten Plätze im Tal. Man überblickt die ganze Siedlung. Ich bin auch gern hier«, sagte Klotho Papantoniou. Sie leitete das Projekt und verdankte es nur ihrer Vorsicht und der Abgeschiedenheit dieses Ortes in den Hochanden, dass ihre Organisation Moíra hier nahezu ungestört arbeiten konnte.
Aus einem mitgebrachten Baumwollbeutel zog sie eine Thermoskanne und drei Becher, die sie auf das Tischchen stellte und mit Tee füllte. Währenddessen trat die zweite Person heran. Sie stellte zwei Klappstühle auf, die an der Araukarie gelehnt hatten. Walter musste die Augen erneut zusammenkneifen, damit er auch sie erkannte.
»Amélie, was für eine Freude! Besuchen Sie Ihre Mutter?«
Amélie wich dem fragenden Blick aus, als das Wort ‘Mutter’ fiel. »Ich bin viel zu selten hier«, murmelte sie schließlich.
»Wie geht es Ihnen? Hatten Sie eine angenehme Reise?«
»Es ging. Ich wurde im Flieger gut versorgt. Nur der Jetlag macht mir ein wenig zu schaffen.«
»Wo ist eigentlich Logan?« Walter blickte sich um. »Sie werden doch Ihren Freund nicht zu Hause gelassen haben.«
»Leider doch. Er befindet sich wieder mal auf etwas, das er Clantreffen nennt. Er macht immer ein großes Brimborium darum. Weiß der Himmel, was die da treiben. Aber ich werde es bald herausfinden. Bei einem der nächsten Male darf ich nämlich mit. Ich bin schon sehr gespannt.«
»Mir scheint, Ihnen haben die Monate, die Sie jetzt zusammenwohnen, gutgetan.«
»Wir sehen uns leider nur am Wochenende. Er arbeitet ja noch in Cambridge, aber wir besuchen uns wechselseitig.«
»Ich freue mich, dass wenigstens Sie beide etwas Leben in die leeren Räume meines Pariser Hauses bringen.«
»Und ich bin froh, dass wir bei Ihnen wohnen dürfen.« Amélie setzte sich Walter gegenüber und lächelte ihn an. »Es fühlt sich zwar immer noch nach der Flucht an, die es eigentlich war, aber ich habe in der Stadt gute Freunde, die mich auffangen, wenn mir wieder die Decke auf den Kopf fällt.«
»Hoffentlich haben Sie das Attentat mittlerweile verarbeitet.«
»Ich beschäftige mich. Es war ein ziemlicher Schock für mich, als ich erkannte, dass man einen Romeo eingesetzt hat, um über mich Druck auf meine Mutter auszuüben. Die Arbeit hilft mir, darüber hinwegzukommen. Meine Kurse am St. John’s kann ich glücklicherweise auch online halten. Die Collegeleitung hat Verständnis für meine Situation.«
Walter versuchte erfolglos, sich in seinem Rollstuhl ein wenig aufzurichten. Amélie sah das, stand auf, half ihm dabei, zog anschließend eine Decke wieder hoch und platzierte eines der Kissen in seinem Rücken. Klotho reichte währenddessen die Teebecher herum, aus denen es aromatisch duftete.
»Auf das junge Paar!«, sagte Walter, lächelte und tat so, als würde er seinen Gegenübern zuprosten. »Und auf Ihre Mutter, die mir hier in den letzten Wochen meines Lebens Unterschlupf gewährt.«
»Ich wünschte, du wärst früher zum Arzt gegangen.« Klotho blickte ihn an und kniff die Augen ein wenig zusammen. Ob sie das Licht blendete oder ob eine Träne in ihrem Augenwinkel schimmerte, konnte Walter nicht genau erkennen. »Vielleicht hätten sie dir dann noch helfen können.«
»Das lässt sich nicht mehr ändern. Ich hatte ein erfülltes Leben. Eigentlich bedaure ich nur eines: dass ich nicht mehr Zeit mit dir verbracht habe.«
»Da geben wir uns wohl beide nichts«, sagte Klotho und strich ihm mit dem Handrücken zärtlich über das Gesicht. »Ich fand auch viel zu lange, dass das Wort Liebe in meinem Leben keinen Platz hat.«
Walter schmiegte seine Wange an ihre Hand.
»Walter … es ist so, dass … dass ich … dass wir«, Amélie blickte hilfesuchend ihre Mutter an, die ihr liebevoll zunickte und den Faden aufnahm:
»Wir müssen etwas Persönliches mit dir besprechen. Etwas, das ich dir schon lange hätte sagen sollen.«
»Dann mal raus damit«, ermutigte Walter sie.
»Du hast mich nie gefragt, wer eigentlich Amélies Vater ist.«
»Ich weiß erst seit einem Jahr, dass du ihre Mutter bist und war mir nicht sicher, ob ich berechtigt bin, diese Frage zu stellen.«
»Du erinnerst dich an das Konzert im Central Park 1981?«
»Wie könnte ich das je vergessen? Ich habe dort einen der schönsten Abende meines Lebens verbracht und hatte eine bezaubernde Frau an meiner Seite.« Walter warf dabei einen wehmütigen Blick auf Klotho.
»Du bist immer noch der alte Charmeur.« Klotho trank einen Schluck Tee und freute sich, dass sie Becher benutzten, und keine Tassen, sonst hätte Walter am Klappern der Tasse auf der Untertasse bemerkt, wie sehr ihre Hand zitterte. »Nun, es ist so, dass Amélie neun Monate nach dieser wunderbaren Nacht geboren wurde, von der ich im Übrigen keine Minute bereue.«
Walter wirkte von einer Sekunde auf die andere so abwesend, daß die beiden Frauen ihm besorgt zusahen. Er stellte seinen Teebecher ab, legte den Kopf zurück und kurz schien es so, als wolle er einschlafen. Klotho setzte gerade zu einer Frage an, da öffnete er die Augen wieder.
»Wir haben nie über diese Nacht gesprochen. Du bist zu emanzipiert und ich war zu schüchtern.« Walter sagte das zwar ruhig und sachlich, aber seine Stimme vibrierte stärker, als sie das sonst tat. »Eigentlich weiß ich aber schon lange, dass du, Amélie, meine Tochter bist. Seit dem Moment, in dem ich dein Geburtsdatum erfahren habe. Ich kann schließlich rechnen. Komm, laß dich umarmen.«
Amélie beugte sich zu ihm herüber und schlug die Decke ein wenig zurück, damit Walter seine Hände wieder frei bekam. Dann stand sie auf, kniete sich neben seinen Stuhl, nahm ihn vorsichtig in den Arm und strich ihm zärtlich über die verbliebenen Haare. Die beiden hielten sich eine ganze Weile umschlungen und Walter gab ihr einen Kuss auf die Wange.
Schließlich brach Klotho das Schweigen: »Ich bin übrigens an dieser Situation schuld. Ich habe Amélie gebeten, das Geheimnis für sich zu behalten. Ich hatte Angst, dass es dich und mich angreifbar macht.«
»Du und deine Neurosen. Einen Teil der Schuld trage ich aber selbst. Ich habe unseren Kontakt viel zu oft nur auf das Geschäftliche beschränkt. Das bereue ich schon lange.« Walter löste sich aus Amélies Umarmung und blickte eine kleine Weile in seinen Schoß. »Ich habe wohl keinen Grund, dir Vorwürfe dafür zu machen, dass auch du deine Prioritäten gesetzt hast.«
Klotho und Walter führten diese kurze Unterhaltung in einem so abgeklärten Tonfall, als ob es um eine geschäftliche Verhandlung ginge. Amélie blickte einige Male zwischen beiden hin und her und schüttelte dann den Kopf. Sie blickte schließlich stumm zu Boden und redete erst nach einer ganzen Weile weiter und rang sichtlich nach Formulierungen:
»Liebe Mama, lieber … Vater … es ist ja schön, dass ihr euch gegenseitig von aller Verantwortung freisprecht. Ich hätte mir als Kind dennoch gewünscht, dass ihr mehr für mich da gewesen wärt. Ihr beide!«
Ihre Augen blitzten dabei und ihre Stimme klang so zornig, dass Klotho und Walter einen betretenen Blick wechselten.
»Stattdessen habe ich Jahre in Internaten verbracht.« Klotho machte eine Handbewegung und schien sie unterbrechen zu wollen, aber Amélie redete einfach weiter: »Mama, mir ist klar, dass du im Rahmen deiner Möglichkeiten alles für mich getan hast, und schlecht ist mir die Schule auch nicht bekommen. Ich habe dort gelernt, mit dem zu leben, was ich erhalte. Deine Geheimnisse für mich zu behalten, ist aber manchmal verdammt schwer. Erwartet also bitte keine Absolution von mir!«
Sie blinzelte einige Male und wischte sich mit dem Ärmel fahrig durchs Gesicht. Dann stand sie auf und ging, so schnell es auf der abschüssigen Fläche möglich war, wieder ins Tal hinunter. Sie wurde erst langsamer, nachdem sie den Steg hinter sich gelassen hatte, der einen den Araukarienhügel umfließenden Bach überquerte.
Walter sah, daß Klotho Anstalten machte, ihr zu folgen und hielt sie zurück.
»Warte bitte. Du weißt schon, dass sie recht hat. Wir waren beide keine guten Eltern.«
»Natürlich weiß ich das, verflucht! Ich fühle mich nur gerade selbst zum Heulen.«
Walter hob die Augenbrauen über Klothos unerwarteten Gefühlsausbruch.
»Ich doch auch. Zum Glück packen mich die Schmerzmittel in Watte, sonst …« Auch Walter musste schlucken.
»Ich bin immer irgendwelchen Sachzwängen gefolgt«, schimpfte Klotho. »Ich hätte mich stattdessen auch einmal nach meinen Gefühlen richten sollen. Sie hat völlig recht, sauer zu sein.«
»Besser, die Einsicht kommt spät, als nie. Ich fühle mich jedenfalls erleichtert, dass die Fakten jetzt auf dem Tisch liegen. Dann habe ich mein Testament nicht umsonst geändert.«
»Du hast … was bitte?«
»Mein Testament. Schon vor einigen Monaten. Amélie soll mein Haus erhalten. Sie lebt ja sowieso schon dort und weitere Verwandte habe ich nicht mehr. Mein Geld geht an deine Organisation verbunden mit einer Bitte.«
»Du hast Hintergedanken? Wie ungewöhnlich.« Normalerweise kamen die Hintergedanken von Klotho.
»Ich möchte, dass du ein Auge auf Monsieur Peters hast. Ihr werdet bald vor einer Herausforderung stehen, die ihr nur zusammen lösen könnt.«
»Was für eine Herausforderung meinst du?«
»Es ist nichts, auf das du dich vorbereiten könntest. Sorge bitte nur dafür, dass Peters dich erreichen kann, wenn es so weit ist.«
»Ich werde es mir überlegen.« Klotho wich Walters Blick aus. »Du klingst übrigens gerade wie Kassandra.«
»Oh, ich habe noch mehr Prophezeiungen. Vergiss nur bitte nicht, dass Kassandra am Ende immer recht hatte, obwohl ihr niemand geglaubt hat.«
»Bist du sicher, dass du nicht fieberst? Es ist heiß, aber du hast dich unter deiner Decke verkrochen, als wäre tiefster Winter.« Klotho fühlte mit der Hand seine Stirn.
»Es ist wohl so, dass man in meiner Situation für Entwicklungen empfänglicher wird, die man sonst nicht wahrnimmt. Ich möchte dich aber um noch etwas bitten. Es wird sich für dich verrückt anhören.«
»Noch verrückter?« Eine steile Falte erschien auf Klothos Stirn.
»Ja. Ich glaube daran, dass wir nach unserem Tode in den Erinnerungen der anderen weiterleben. Wenn ich dich in deinen Träumen besuche, solltest du mir zuhören. Versprichst du mir das?«
Klotho nahm Walters Hände in ihre. »Mich besuchen? Du drückst dich gerade ziemlich schwer verständlich aus. Na gut, ich verspreche es. Auch wenn ich nicht verstehe, welchen Sinn das haben soll.«
»Das wirst du noch.«
»Warum vermittelst du mir das Gefühl, als wüsstest du etwas, das ich nicht weiß?«
»Ich kann nicht darüber reden. Die oberste temporale Direktive gilt nicht nur für Zeitreisen.« Walter zwinkerte ihr freundlich zu. »Und jetzt geh zu deiner Tochter – unserer Tochter – und bitte sie für mich um Verzeihung.«
»Wenn, dann für uns beide! In diesem Punkt hast du recht, auch wenn ich gerade das Gefühl habe, dass du ansonsten ziemlichen Unsinn redest.« Mit diesen Worten stand sie auf und verschob seinen Rollstuhl so weit, dass er sich auch in den nächsten Stunden im Schatten des Baums befinden würde. »Ich hole dich später ab. Schlaf jetzt ein wenig.«
»Schlafen kann ich noch genug.«
Walter sah ihr hinterher, bis sie den Steg über den Bach überquert hatte. Dann nahm er sein Buch wieder zur Hand und begann zu lesen. Nicht lange allerdings, dann fielen ihm die Augen zu und er ließ das Buch sinken. Die ruckartigen Bewegungen seiner Augäpfel unter den geschlossenen Lidern verrieten, dass er träumte.
Klotho fand Amélie weiter unten am Bach. Sie hatte Schuhe und Socken ausgezogen, die Hosenbeine hochgekrempelt und kühlte ihre Füße im strömenden Wasser. Klotho blieb kurz bei ihr stehen, dann entledigte sie sich ebenfalls ihrer Schuhe und Socken und setzte sich daneben. Eine ganze Weile saßen die beiden da und blickten auf die Paneele des Solarkraftwerkes, die sich die gegenüberliegenden Hügel hochzogen, ohne dass ein Wort fiel. Erst nach einigen Minuten brach Klotho das Schweigen:
»Du hast völlig recht, mein Kind. Was ich dir zugemutet habe, ist nicht in Ordnung.«
»Das war es nie.« Amélies Stimme schwankte. »Ich weiß schon, dass ich mit Verpflichtungen aufgewachsen bin, denen ich mich nicht entziehen kann. Mir ist nur gerade klar geworden, wie schön es hätte sein können, wenn ihr zwei zusammengelebt hättet. Das hat mich für einen Augenblick überwältigt.«
»Ich kann dich nur in meinem und Walters Namen um Verzeihung bitten. Wir wissen mittlerweile auch, dass wir es zusammen hätten viel schöner haben können. Wir standen uns selbst im Weg.« Sie legte versuchsweise einen Arm um Amélies Schultern und – als sie sich der Liebkosung nicht entzog – zog sie sie an sich. »Ich habe gedacht, ich schaffe das allein. Du musst mir nur glauben, dass ich dich über alles liebe und dass sich daran nie etwas ändern wird.«
»Das weiß ich doch, Mama.« Amélie erwiderte die Zärtlichkeit und streichelte ihrer Mutter über den Handrücken. »Komm, laß uns zu Walter zurückgehen. Ich habe nicht mehr viel Zeit, meinen Vater kennenzulernen.«
»Ich vermute, er schläft jetzt. Lassen wir ihn zunächst in Ruhe. Heute Abend ist auch noch Gelegenheit.«
»Heute und an den kommenden Tagen. Ich bleibe ja über die Feiertage hier.«
Klotho blickte zur Seite, so dass ihre Tochter nicht sehen konnte, dass sie lächelte. Ein glückliches Lächeln.
Kapitel 1. Mike und Maurice (25.02.2018)
»Haste eigentlich immer noch diese Tagträume?«
Maurice lag neben seinem Freund auf dem Bett und hatte die Arme hinter seinem Kopf verschränkt. Im Webradio liefen Chansons. Mike las in einem Frank Schätzing, der ihn ziemlich zu absorbieren schien, denn es dauerte eine Weile, bis er antwortete:
»Selten, aber sie sind nie ganz weg. Gestern Abend habe ich mich plötzlich wieder an meine Studentenzeit in Bielefeld erinnert und bin erst nach einigen Minuten wieder in die Realität zurückgekehrt.«
»Bielefeld? Kenn ich nicht.«
»Da hast du nichts verpasst. Selbst die Deutschen sagen im Scherz, dass es diese Stadt gar nicht gibt.«
»Es muss sie geben, wenn du dort studiert hast. Wie bist du danach eigentlich nach Paris gekommen?«
»Es handelte sich um ein deutsch-französisches Studium. Die erste Hälfte in Deutschland, die restliche Zeit in Paris.«
»Dieses Bielefeld ist also in Deutschland?«
Mike warf einen scharfen Blick auf seinen Freund, aber dessen Gesichtsausdruck ließ keine Deutung zu, wie er das meinte.
»Du verarschst mich gerade, oder?«
»Ja.«
Mike legte sein Buch beiseite, drehte sich zu seinem Freund und umarmte ihn zärtlich. Der ließ sich das knurrend gefallen.
»Weißt du, dass mir deine Wohnung richtig gut gefällt?«, sagte Mike dabei. »Ich habe mich schon beim ersten Mal in sie verliebt, als du nach dem Messerstich im Krankenhaus lagst und ich deine Blumen gegossen habe.«
»Sie ist größer als deine«, entgegnete Maurice. »Das ist nen Vorteil. Manchmal wirds mir aber auch zu eng. Ich bin manchmal froh, wenn du unter der Woche in dein Apartment zurückfährst und ich wir beide unsere Ruhe haben. Außerdem gefällt mir die Lage nicht mehr.«
Maurices’ Wohnung lag im neunzehnten Arrondissement im Norden von Paris und grenzte an die Vorstadt, die sogenannte Banlieue. Seit einer heftigen Auseinandersetzung mit Omar, einem der dortigen Bandenchefs, verließ er die Wohnung eigentlich nur, um ins Zentrum zu fahren, und ließ sich im Quartier kaum noch sehen. In letzter Zeit verbrachten sie aber meist ihre gemeinsamen Wochenenden hier, weil Mikes Apartment im Marais für zwei Personen auf Dauer wirklich zu klein ausfiel.
»Vielleicht sollten wir uns nach einer größeren Wohnung umsehen.«
»Du verarschst mich.«
Maurice zeigte seine Gefühle ungern und setzte selbst seinem Freund gegenüber des öfteren ein Pokerface auf.
»Nein!« Mike richtete sich ein Stück auf und stützte sich auf die Ellbogen. »Ich träume sogar nachts manchmal davon, dass wir zusammenwohnen. Wäre das denn so schlimm?«
»Weiß nicht.«
Immerhin bügelte Maurice das Thema nicht gleich in seiner schroffen Art ab. Das zeigte Mike, dass der sich auch schon mal mit diesem Gedanken beschäftigt hatte.
»Hast recht, es läuft gut mit uns in letzter Zeit«, sagte Maurice nach kurzem Nachdenken. »Als wir gemeinsam auf der Insel Urlaub gemacht haben, dachte ich zwischendurch, wir sehen uns danach nie wieder.«
»Ja, aber dann haben wir doch den Dreh bekommen. Ich denke, jeder braucht nur genügend Platz für sich, wo er schalten und walten kann und wo wir uns auch mal aus dem Weg gehen können, wenn der Haussegen schief hängt oder einer eine Auszeit braucht. Dann könnte es klappen.«
»Ich denk drüber nach.«
»Soll ich in den nächsten Wochen mal auf die Suche gehen?«
»Ich denk drüber nach!«
Mike kannte seinen Freund gut genug, um zu wissen, dass er das Thema erst einmal nicht wieder anschneiden durfte. Aber er fand, dass es besser lief, als er hatte erwarten können. Und Maurice vergaß solche Dinge nicht. Er würde die Idee irgendwann von sich aus ins Gespräch bringen und dann konnten sie weitersehen. Bei den Mieten in Paris würden sie sowieso mit spitzem Bleistift rechnen müssen, wenn sie sich nach einer größeren Wohnung umsahen. Lächelnd legte er sich wieder auf den Rücken und nahm sein Buch zur Hand.
Lange konnte er aber nicht weiterlesen.
»Diese rechte Schmierseite ist nicht gut auf euren Verlag zu sprechen. Gabriel sagt, sie hetzen nicht nur gegen die Stadtverwaltung, sondern auch gegen linke Pseudowissenschaftler. Damit meinen sie euch.«
»Damit kann ich leben.« Mike blickte zwar von seinem Buch auf, wirkte aber nicht sonderlich besorgt. »Wir haben im letzten Jahr mit einigen Artikeln klar Position gegen eine ihrer populistischen Kampagnen bezogen.«
Mike arbeitete als Redaktionsleiter im Magazine de la Science, einer populärwissenschaftlichen Zeitschrift. Mit Hilfe von Informationen der Gruppe Moíra hatten sie eine große Anzahl wissenschaftlicher Studien als Fälschungen entlarven können. Der Boulevard Atlantique, ein rechtspopulistisches Nachrichtenportal, wollte die Studien groß herausbringen und fiel dank Mikes Enthüllungsartikel damit auf die Nase.
»Wenn sie eine Chance sehen, euch ans Bein zu pinkeln, werden sie die nutzen.«
Mike hob erst die Brauen. Dann grinste er plötzlich.
»Um in Deiner Diktion zu bleiben: Was kümmert es den Baum, wenn eine Wildsau sich daran scheuert?«
»Diktion? Rede verständlich mit mir!«
»Tut mir leid. Ich meine Ausdrucksweise.«
»Verstehe. Du musst sie trotzdem ernst nehmen.«
»Ich weiß, dass sie Verbindungen bis weit in die politische Mitte besitzen. Ich denke mittlerweile, dass der Hedgefonds, der im letzten Jahr zwischenzeitlich das Magazine übernommen hatte, auch aus dieser Ecke kam. Nachdem wir ihn wieder aus dem Verlag gedrängt hatten, kündigten gleich mehrere Unternehmen ihre Anzeigen bei uns. Wir konnten das dank der Hilfe von Moíra auffangen, aber das Signal, dass wir aufpassen müssen, ist klar.«
»Der Untersuchungsrichter hat immer noch Sorge, dass dieser Geheimbund euch beeinflusst. Auch Kommissar Lefebvre ist nicht gut auf sie zu sprechen.«
»Sie versorgen uns wirklich nur mit Artikeln. Du musst mir glauben, dass aus dieser Richtung keine Gefahr droht.«
»Du erzählst mir nicht alles«, stellte Maurice lakonisch fest.
»Gleichfalls«, kam die trockene Antwort. »Nicht nur du musst schweigen, wenn ihr bei der Kripo einen Fall aufklären wollt. Ich darf auch nicht über alle Firmeninterna reden. Bis jetzt sind wir auf dieser Basis doch immer gut zurechtgekommen.«
Maurice nickte und schwieg. Zufrieden wirkte er aber nicht, denn er nahm die Arme hinter seinem Kopf hervor und setzte sich brummelnd auf die Bettkante.
Kapitel 2. Oleg (26.02.2018)
»Großvaters Verfügung für diesen Fall lässt keinen Spielraum für Interpretationen.«
»Das sehe ich auch so.«
Die beiden Männer, die sich auf Russisch unterhielten, standen am Krankenbett eines sehr alten Mannes. Die Monitore am Kopfende zeigten eine Reihe von Vitaldaten. Spritzenautomaten brummten und ein Bündel von Schläuchen führte dem Patienten Medikamente und Nährstoffe zu. Verkrampft lag er unter einer dünnen Decke.
Zu keinem Zeitpunkt in seinem langen Leben konnte man ihn dick oder auch nur wohlgenährt nennen. Jetzt aber bestand der Körper nur noch aus Haut und Knochen. Der Kopf ähnelte jetzt schon mehr einem Totenschädel als einem lebenden Wesen und die milchblauen Augen, vor dessen Blick früher einmal Konzernchefs und Präsidenten gezittert hatten, hatten sich geschlossen.
»Der Arzt sagt, er wird nicht mehr aufwachen. Das bedeutet, dass ich ab sofort die operative Leitung des Konsortiums übernehme. Bereiten Sie die nötigen Papiere vor. Wir wollen keine Zeit verlieren. Ich möchte vermeiden, dass es unter den Mitgliedsorganisationen Unruhe betreffs der Nachfolge gibt. Lassen Sie mich jetzt bitte allein, Juri. Ich will mich verabschieden.«
»Jawohl!« Der ältere Mann hob die Hand, als wollte er salutieren, unterbrach seine Geste aber und entfernte sich wortlos. Bereits in der Tür zückte er sein Handy und begann, Nachrichten zu tippen.
Der Jüngere zog sich aus einer Ecke des Krankenzimmers einen Hocker heran und setzte sich an die Seite des Bettes. Er nahm die Hand des Schwerkranken und legte sie zwischen seine eigenen. Kalt fühlte sie sich an. Die Kälte des nahen Todes. Bis zuletzt hatte er sich an das Leben geklammert und darauf bestanden, die Geschäfte weiterhin selbst zu leiten.
Oleg erinnerte sich an regelmäßige Diskussionen, die der Alte mit seinen Pflegern um eine Erhöhung der Schmerzmitteldosis geführt hatte. Nur sie ermöglichten es ihm überhaupt noch, am Leben teilzunehmen. Vor einigen Tagen war er aber dann doch zusammengebrochen und lag seitdem im Koma. Zu lange hatte er seinen Körper geschunden, um noch eine Woche, einen Tag, eine Stunde mehr herauszuholen. Jetzt waren auch seine letzten Reserven verbraucht.
Mehr als irgendjemand vor ihm hatte er dem Konsortium, einem Zusammenschluss großer Unternehmen mit anderen, mehr oder weniger geheimen, Organisationen, in den letzten Jahrzehnten seinen Stempel aufgedrückt. Mit unnachgiebiger Härte hatte er die Gruppe durch die Wirren der Jahrzehnte nach Gorbatschow und Reagan geführt und machte sie zu einem Machtfaktor in der Weltpolitik, an dem kein Herrscher und keine Regierung vorbeikam. Von der Öffentlichkeit blieb dies weitgehend unbemerkt. Der Alte, wie er von seinen Untergebenen mehr angst- als respektvoll genannt wurde, hatte alle Fäden im Hintergrund gezogen.
Jetzt war es Zeit für ihn, abzutreten. Er hatte seinen Enkel schon seit einigen Jahren in die Leitung der Geschäfte mit einbezogen und er, Oleg Fjodorowitsch Melnikow, fühlte sich bereit. Niemand würde seine Ansprüche bestreiten.
»Machs gut, Großvater«, sagte er leise und drückte die knochige Hand, die unter der Decke hervorschaute. »Du wärst nicht einverstanden mit dem, was ich jetzt tue, aber du hast deine Schmerzen lange genug ertragen.«
Ein tiefer, stöhnender Atemzug kam als Antwort und ein Zittern lief durch den ausgezehrten Körper. Oleg stand auf und verließ das Krankenzimmer. Draußen erwartete ihn ein Arzt.
»Schalten Sie bitte seine Ernährung ab und geben Sie ihm genügend Schmerzmittel. Ich will nicht, dass er leidet. Jetzt nicht mehr.«
Kapitel 3. Logan (So. 04.03.2018)
Auf dem Tisch im Wohnzimmer stand eine dampfende Portion Toad in the Hole. Logan hatte sich an seinem Lieblingslieferdienst für einige Zeit sattgegessen und kochte daher wieder selbst.
Er aß zu Abend und verfolgte derweil die Nachrichten. Ein Reporter berichtete ausführlich über einen russischen Dissidenten und seine Tochter, die man am Tage in Salisbury bewusstlos auf einer Parkbank gefunden hatte. Genau wusste noch niemand über die Ereignisse Bescheid, aber der Name Sergei Skripal machte sie zu einer Schlagzeile. Stockend gab ein Wissenschaftler ein Statement über ein möglicherweise verwendetes Gift, ein Korrespondent von irgendwo erteilte Auskunft über das, was man derzeit über russische Verschwörungen zu wissen glaubte. Logan ließ das kalt. In den nächsten Tagen würde sich alles zu einem Bild sortieren.
Unter der Woche verbrachte er die meiste Zeit bei der Firma für Datenauswertung, bei der er eine Stelle für ein Praktikum ergattert hatte. Am St. John’s College besuchte er nur noch wenige Vorlesungen, denn sein Studium hatte er fast beendet. Zweiwöchentlich fuhr er für ein verlängertes Wochenende nach Paris zu seiner Freundin; an den anderen Wochenenden besuchte Amélie ihn meistens. So sahen sie sich regelmäßig, obwohl Logan sich entschieden hatte, zunächst in Cambridge zu bleiben und erst später bei Amélie einzuziehen.
Nur an diesem Wochenende konnten sie sich nicht sehen, weil seine Freundin gestern zu einer Testamentseröffnung hatte erscheinen müssen. Professor Stein aus Paris, den er nur aus Erzählungen kannte, war Ende Februar gestorben und anscheinend handelte es sich bei ihm um Amélies Vater. Das wenige, das Amélie ihm dazu bisher erzählt hatte, ließ aus seiner Sicht Fragen offen. Überhaupt wußte er bisher erstaunlich wenig über ihre Familie. Anscheinend mußte er da nachfragen und nicht hoffen, daß sie ihm von sich aus alles erzählte.
Nach dem Essen war er durstig. Zu viel Salz in der Kröte und ein verliebter Koch, dachte er sich, als er ein Glas Wasser aus der Küche holte. Seinen Durst stillte das jedoch nicht und so beschloss er, in einen Pub zu gehen. Er zog sich um und stapfte dann die Treppen hinunter zum Ausgang der Wohnanlage.
Vor einer Tür im Erdgeschoss stand eine volle Plastiktüte. Er warf einen Blick hinein, zog die Nase kraus und lächelte. Misses Cartwright hatte ihren Müll vor die Türe gestellt. Sie war über neunzig und seit er hier wohnte, nahm er ihr regelmäßig Besorgungen ab, kaufte für sie ein und erklärte ihr einmal in der Woche ihre Kontoauszüge. So hob er den Beutel auf und warf ihn draußen in den großen Container.
Als er die Apartmentanlage in Pinehurst verließ, peitschte ein böiger Westwind feinen Nieselregen übers Land. Er schlug den Kragen seiner Lederjacke hoch und machte sich auf den Weg zur King’s Parade. In die Pubs dort gingen die Leute, die er kannte. Der Regen fiel so fein, dass man ihn in den Straßenlaternen nicht sah. Nur wenn er mit der Hand den direkten Laternenschein vor den Augen abdunkelte, sah er im Halo der Lampen die Tröpfchenschwaden vorbeiziehen.
Sein Smartphone klingelte. Er fuhr mit dem Finger über den Bildschirm, ohne aufs Display zu sehen, nahm es ans Ohr und meldete sich: »Hallo?«
»Was meinst du, wer da ist?«, fragte eine ihm wohlbekannte Frauenstimme.
»Lassen Sie mich raten, Ma’am«, sagte er und bemühte sich um einen besonders breiten schottischen Akzent. »Sie sind der Lieferdienst, der mich gerade zu Hause nicht angetroffen hat?«
»Blödmann«, kicherte es aus dem Lautsprecher. »Hier ist Amélie.«
»Hallo, meine Geliebte.«
»Wo bist du? Es klingt, als wärest du draußen.«
»Unterwegs zu einem Pub. Mir ist langweilig.«
»Da wäre ich jetzt gerne dabei. Ich brüte immer noch über Walters Testament und kann es nicht fassen, dass ich dieses riesige Haus erben soll.«
»Hat er es dir denn nicht erzählt, als du ihn vor Weihnachten besucht hast?«
»Nein. Mama wusste es, aber die hat wieder einmal nichts gesagt.«
»Kann es sein, daß ihr alle etwas wenig miteinander redet?«, fragte Logan konsterniert.
Eine kleine Weile blieb es still im Hörer. »Das ist eines der größeren Mankos in meiner Familie«, antwortete Amélie dann gedehnt.
»Als Hausbesitzerin in Paris bist du aber jetzt eine richtig gute Partie. Ob du den armen Studenten dann überhaupt noch willst?«, überspielte Logan seine Frage, die offensichtlich unangenehm für seine Freundin gewesen war.
»Klar will ich den. Zum ersten Mal in meinem Leben läuft wirklich alles richtig!«
Das klang schon viel besser. Ein glückliches Lächeln huschte über Logans Gesicht.
»Ich vermisse dich«, sagte er dann mit Nachdruck. »Ich würde jetzt viel lieber mit dir ausgehen.«
»Keine Sorge, in der nächsten Zeit sehen wir uns wieder regelmäßiger. Vielleicht kann ich sogar mal eine Woche bei dir bleiben. In diesem großen Haus wartet hinter jeder Ecke mein Vater auf mich.«
»Das wäre toll. Wir könnten unseren Aufenthalt in Schottland am kommenden Wochenende um einige Tage verlängern. Was meinst du? Die Goldene Hochzeit wird nämlich groß gefeiert. Du wirst viele Leute kennenlernen, die mir etwas bedeuten.«
Gespannt wartete Logan auf die Antwort. Amélie ließ sich ein wenig Zeit damit. Wäre Logan nicht gerade spazierengegangen, so wäre er wohl von einem Bein aufs andere getreten.
»Darauf freue ich mich schon und ich denke, das geht. Vielleicht verstehe ich danach auch besser, wie ihr Kerrs so tickt.«
»So schlimm ist es nicht. Wenn wir jemanden mögen, dann richtig. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass dich jemand nicht mögen würde.«
»Keine böse Schwiegermutter?«
»Schwiegermutter setzt voraus … möchtest du …« Logan rang nach den richtigen Worten, »dass ich dir … einen Antrag mache, so richtig formell, auf Knien und so?«
Stille in der Leitung. Logan sorgte sich, dass er sich im Ton vergriffen hatte, und wollte seine Bemerkung schon als Scherz relativieren. Da antwortete Amélie:
»Ein Antrag? Du gehst ja ran! Wobei … wenn ich es recht besehe, denke ich darüber auch schon eine Weile nach.«
»Ein Glück.« Logan fiel ein Stein vom Herzen. »Ich hatte gerade Sorge, du hättest das falsch verstanden. Dann verloben wir uns also demnächst?«
»Ja, ich finde auch, dass es Zeit wird. Du hast mich im letzten Jahr sehr glücklich gemacht.«
»Dito!« Sein Herz machte einen Hüpfer. »Darf ich dann also ankündigen, dass wir zusammen erscheinen?«
»Natürlich! Soll ich uns ein Hotelzimmer buchen?«
»Das brauchst du nicht. Wir fahren erst nach Perth und übernachten bei Mutter. In meinem alten Kinderzimmer steht mittlerweile ein französisches Bett. Das sollte reichen. Dann fahren wir in die Highlands. Die Feier findet bei einem meiner Großonkel statt. Er besitzt einen kleinen Gutshof. Dort gibt es genügend Zimmer für alle.«
»Wie ich deinen Hang zu Untertreibungen kenne, bedeutet das, dass er ein Schloss besitzt.«
Logan war froh, dass Amélie jetzt nicht sehen konnte, wie er errötete. »Du glaubst nicht, wie ich mich freue«, sagte er schließlich.
»Ich mich doch auch! Oh, es klingelt. Da kommt mein Essen. Wollen wir später noch mal telefonieren?«
»Klar doch!«
Logan verabschiedete sich und legte auf. Mittlerweile lief er durch die Trumpington Street und sah vor sich die Lichter der Läden in der King’s Parade. Er betrat gleich den ersten Pub an einer der nächsten Straßenecken. Vor der Theke standen einige Gäste in einer kleinen Schlange und es dauerte ein wenig, bis er sich mit einem Lager versorgen konnte. Danach schlenderte er durch die nicht allzu voll besetzten Tischreihen.
Einem Gefühl folgend setzte er sich nicht zu seinen Kommilitonen vom College, sondern begrüßte einen der IT-ler, die sein Praktikum betreuten. Er hatte sich mit ihm schon mehrfach und länger unterhalten. Rashid schien im Gegensatz zu manchen Berufskollegen kein Nerd zu sein und kannte durchaus andere Gesprächsthemen als Serverkonfigurationen und Netzwerkroutinen. In seinen wachen, braunen Knopfaugen saß schnell der Schalk, wenn er Zweifel an der Auffassungsgabe seines Gegenübers bekam. Heute wirkte er aber nicht, als fände er etwas lustig. Um seine Augen lagen Schatten und die Brauen hatte er so tief gezogen, dass er gerade noch darunter hervor gucken konnte.
»Kommst du von der Arbeit? Du siehst müde aus«, fragte Logan nach dem Begrüßungshandschlag.
»Ist nur viel zu tun. Das Netz macht Probleme. Wir haben zu viel Traffic für zu wenige Ressourcen.«
»Hoffentlich sind keine Hacker drin«, sagte Logan im Scherz.
»Es ist nicht leicht, die Rechner in Schuss zu halten, an denen ihr Praktikanten ab morgen wieder arbeiten sollt. Noch ein paar Jahre und du findest sie im Museum wieder«, sagte Rashid anstelle einer Antwort. Beide lachten, aber Rashid erwiderte Logans Blick nicht und schien gedanklich mit etwas anderem beschäftigt zu sein.
»Störe ich?«
»Nein, nein, es ist nur gerade alles nicht einfach. Der Chef gibt manchmal komische Anweisungen, aber damit musst du dich nicht belasten.«
Logan nickte. Er hatte Peter, den Chef, bei seiner Einstellung kurz gesehen und empfand ihn als ziemlich unzugänglich. Kein Sympathieträger, mit dem man sich gern verbrüderte.
»Falls du Hilfe brauchst … du weißt ja, was ich kann und was nicht.«
»Die Art Hilfe benötige ich nicht, aber vielleicht brauche ich die Tage mal jemanden zum Reden. Du hast eine freundliche Seele. Meine Familie hat einen Blick für so etwas.«
Logan lächelte überrascht. Dann zog er sein Handy und öffnete eine SMS.
»Gib mir deine Nummer.« Er tippte die Zahlen in das Adressfeld, schrieb Ich bin Logan Kerr in die Nachricht und schickte sie an Rashid. Der öffnete sie und lächelte ebenfalls. Ein kurzer Fingerwirbel auf dem Display und Logans Handy pingte ebenfalls. Danke. Rashid Anand. Beide lächelten und steckten ihre Telefone wieder ein.
»Das ist doch ein Scherz mit der Seele, oder?«, fragte Logan unsicher.
»Jein. Meine Familie ist kastenlos. Für uns ist es auch heute noch überlebenswichtig, sofort einschätzen zu können, wie jemand drauf ist und wie etwas Gesagtes wirklich gemeint ist.«
Logan sah, was sein Gegenüber meinte. Im letzten Jahr war er mehrfach unsanft darauf gestoßen, dass er mit seinem Verständnis der Dinge in vielen Bereichen erst an der Oberfläche kratzte. Ein Kampf weltumspannender Geheimorganisationen um ein geöffnetes Dimensionsportal mit spukhaften Fernwirkungen hatte sein Leben auf den Kopf gestellt. Zu viele Wunder warteten in dieser neuen Welt, die sich ihm offenbart hatte, noch darauf, von ihm gefunden zu werden. So nahm er Rashids treffsichere Intuition nur als eine weitere von vielen Besonderheiten hin.
Kapitel 4. Paolo (04.03.2018)
Jeden anderen hätte dieser Schlag ins Land der Träume befördert, so schnell kam er. Dennoch tauchte Paolo beinahe elegant darunter hinweg und stand Sekundenbruchteile später hinter seinem Gegner. Der fuhr herum und schlug erneut zu. Paolo parierte mit dem Unterarm und lenkte den Schlag knapp an seinem Kopf vorbei. Mit einem Judogriff nutzte er den Schwung seines Gegners aus und brachte ihn aus dem Gleichgewicht. Ein Tritt gegen die Kniescheibe und er flog krachend zu Boden und landete auf dem Rücken. Paolo kniete sich über ihn und setzte ihn mit zwei gezielten Handkantenschlägen gegen die Halsschlagadern außer Gefecht.
Langsam richtete er sich wieder auf. Er war nur wenig außer Atem. Der andere würde ein Weilchen benötigen, um wieder er selbst zu sein.
»Gut gemacht. Du hast meinen besten Mann besiegt. Und du hast deine Gabe nicht mal eingesetzt.«
Ángel, der den Kampf aus einigen Metern Entfernung verfolgt hatte, trat an Paolo heran und wollte ihm mit seiner Pranke auf die Schulter schlagen. Mit einer neuen schnellen Bewegung wich der ihm aus und brachte seinen Trainer so ebenfalls aus dem Gleichgewicht.
»Treib es nicht zu weit.« Das sollte bedrohlich klingen, aber Ángels Augen lachten dabei, etwas, das man bei ihm sehr selten sah. Fast konnte man glauben, dass er den hochgewachsenen jungen Mann mit den strahlend blauen Augen mochte. »Du hast sie doch nicht eingesetzt, oder?«
»Frag ihn selbst, wenn er wieder wach ist.« Paolo hatte es nicht mehr nötig, die Fähigkeiten einzusetzen, die ihn von den anderen Menschen um ihn herum unterschieden. Die Fähigkeiten, wegen derer er sich hier befand. Es genügte ihm, dass er die Absichten seines Gegners einen Sekundenbruchteil vorher erkannte. »Er hat gut gekämpft.«
»Ich kann dir nichts mehr beibringen. Nur ein wirklich großes Manko hast du noch.«
»Welches?« Verwirrt blickte Paolo auf.
»Lerne Spanisch, oder zumindest Englisch. Mein Deutsch ist besser geworden.« Paolo nickte. »Aber diese Worte sind Folter für meine Stimme.«
»Lo intentaré. Lo prometo.«
»Du mich auch.«
»Lehre mich lieber mehr über Geschichte. Cédric hat mir gezeigt, wie wichtig es ist, die Vergangenheit zu kennen.«
Paolos einziger Freund Cédric war viel zu früh bei einer Auseinandersetzung gestorben, die ebenso grausam wie sinnlos gewesen war. Vielleicht hätte er ihn sogar lieben können. Leider hatte das Schicksal ihm diese Chance verwehrt und er konnte froh sein, mit dem nackten Leben davongekommen zu sein. Ángel hatte ihn seinerzeit gerettet, den Bewusstlosen einfach über die Schulter geworfen und hergebracht.
Zwei Monate lag er fiebernd und fantasierend im Hospital. Der Entzug brachte ihn beinahe um. Erst nach und nach, über weitere Monate, funktionierten seine Organe wieder ordnungsgemäß. Sobald er aufstehen konnte, kümmerten sich Ángel oder einer seiner Leute um ihn. Sie sorgten mit Lauftraining dafür, dass sein Körper unter Belastung auch die letzten Reste der Chemikalien abbaute, die er früher im Übermaß konsumiert hatte. Danach hatten sie begonnen, ihn zu trainieren.
Jetzt fühlte er sich wieder so kräftig und beweglich wie früher und langsam fragte er sich, warum er hier war. Wo er sich derzeit aufhielt, spielte für ihn keine Rolle. Er hätte sowieso nicht gewusst, dass es einen Ort wie Chile gab und wo er lag. Der Schulunterricht in den Heimen, in denen er einen großen Teil seiner Kindheit verbracht hatte, verdiente den Namen nicht.
Ángel schien mit seiner Bitte nichts anfangen zu können. »Ich kann dir zeigen, wie man kämpft oder wie man einen Computer bedient. Geschichte habe ich auch nie gelernt. Frag Klotho, ob sie einen Lehrer für dich hat, wenn du das wirklich willst. Sie kann dir helfen.«
Paolo hatte Klotho einige Male kurz gesehen. Sie hatte an seinem Bett gestanden, als er zum ersten Mal wieder aus dem Heilkoma erwacht war, in das man ihn versetzt hatte, und er sah sie auch später einige Male kurz. Sie schien hier alles zu steuern. Wenn es um sie ging, empfing er von allen nur Gefühle wie Respekt und Hochachtung.
»Weißt du, was sie mit mir vorhat? Zu welchem Zweck bin ich hier?« Seltsam, dass ihm diese Frage erst jetzt einfiel.
»Das weiß ich nicht. Sie erzählt uns nicht viel. Sie will uns schützen.«
»Kann ich mit ihr reden?«
»Ich sage es ihr.«
Klotho hatte tatsächlich Zeit für ihn. Sogar derart schnell, dass er sich fragte, ob sie auf seine Bitte nur gewartet hatte. Schon am Nachmittag holte ihn Ángel aus dem Zimmer, in dem er seine Zeit verbrachte, wenn er nicht trainierte.
Klotho begrüßte ihn im Garten ihres Bungalows.
»Paolo, ich freue mich, Sie zu sehen. Nehmen Sie bitte Platz.«
Sie wies auf einen Stuhl ihr gegenüber. Er stand weiter weg von ihr, als Paolo erwartet hatte. Hier draußen im Sonnenschein wirkte die schlanke Frau mit den kurzen, weißen Haaren älter, als er sie in Erinnerung gehabt hatte, irgendwie zerbrechlich. Das lag aber sicher daran, dass er sie auch im Sitzen noch um einen Kopf überragte. Sie musterte ihn so durchdringend, dass er sich fragte, ob sie vielleicht auch seine Gabe besaß.
Ángel hielt sich im Hintergrund und brachte es fertig, ungeachtet seiner eher kompakten Statur beinahe unsichtbar zu werden.
»Sie haben sich gut gemacht, Paolo. Ángel sagt, Sie wären völlig wiederhergestellt.«
Paolo wurde erst jetzt klar, was ihn an ihren Worten irritierte. Sie sprach Deutsch mit ihm und ihr Deutsch war ausgezeichnet! Ángel gab sich zwar große Mühe, aber man hörte mit jedem Wort, das er sprach, wie sehr er sich dabei anstrengen musste.
»Ich fühle mich gesund und einsatzbereit. Wofür auch immer, Frau … Klotho.«
»Nennen Sie mich einfach Klotho. Das tun hier alle. Meinen Nachnamen können Sie sowieso nicht aussprechen.« Sie lächelte ihn dabei an und vermittelte ihm damit das Gefühl, hier willkommen zu sein. »Ángel sagt, Sie benötigen einen Lehrer?«
»Ich möchte gerne lernen. Ich weiß so wenig über die Welt. Da, wo ich herkomme, interessierte man sich nur für meine Fähigkeiten, und nicht für mich.«
»Ich verstehe. Natürlich sind Sie wegen Ihrer Fähigkeiten hier, das muss ich zugeben. Ich vermute, ich könnte Sie sowieso nicht anlügen.« Wieder dieses Lächeln, bei dem er sich wohl fühlte. »Aber ich finde, wir sollten zuerst schauen, was wir tun können, um Ihnen zu helfen. Alles andere wäre unfair.«
»Danke, dass Sie das so sehen.« Paolo versuchte ebenfalls ein Lächeln, das aber weniger selbstverständlich aussah als bei Klotho. Früher hatte er es nicht nötig gehabt, auf solche Details zu achten. Die Droge, die er genommen hatte, hatte seine Sinne so sehr geschärft, dass er automatisch die richtigen Worte gefunden hatte.
»Es ist leider so, dass Ángel und ich außer den deutschen Söldnern die einzigen Personen an diesem Ort sind, die Ihre Sprache sprechen. Deswegen kann ich Ihnen kurzfristig leider keinen Lehrer besorgen. Darum meine Frage: Wie gut können Sie lesen?«
»Geht so. Einige Sätze sind okay, aber mit längeren Texten habe ich Probleme.«
»Gut, dann werden wir auch an Ihrer Lesekompetenz arbeiten müssen. Solange Sie hier sind, kümmere ich mich darum, dass Sie lernen können, was immer Sie wollen.«
Paolos Lächeln geriet jetzt wesentlich natürlicher, denn er fühlte sich wirklich erleichtert.
»Wir machen Folgendes: Ich werde Ihnen Unterrichtssendungen in Ihrer Sprache herunterladen lassen, die Sie sich ansehen können. Sie interessieren sich für Geschichte, sagte Ángel?«
»Ja, Geschichte muss wichtig sein. Ich will verstehen, warum Menschen manchmal so sind, wie sie sind.«
Paolo erinnerte sich nur ungern an eine Situation, die ihm außer Kontrolle geraten war, weil er nicht verstanden hatte, wie sein Gegenüber tickte. Cédric hatte ihn damals gerettet und ihm hinterher erklärt, dass der Mann ein Nazi gewesen war und dass es wegen solcher Leute vor langer Zeit zwei Weltkriege gegeben hatte.
»Sie werden mehr als nur Geschichte lernen müssen, fürchte ich, aber wir werden dort einen Schwerpunkt setzen. Sie bekommen außerdem begleitende Texte zu den Sendungen, die Sie bitte versuchen, durchzulesen, auch wenn Ihnen das am Anfang schwerfallen wird. Ich möchte außerdem, dass Sie Erdkunde lernen. Ohne sie funktioniert Geschichte nämlich nicht. Alles Weitere hängt davon ab, wie schnell Sie lernen.«
»Danke … Klotho. Sie sagten vorhin ‘solange ich hier bin’. Warum bin ich denn hier?«
»Zunächst sind Sie hier, weil Sie an dem Ort, von dem Sie kommen, gestorben wären. Der Platz hier, wir nennen ihn Die Kolonie, ist nämlich in erster Linie eine Zuflucht. Außerdem sind Sie hier, weil Sie mit den Fähigkeiten, die Sie besitzen sollen, helfen können, diese Zuflucht zu beschützen. Es gibt anderswo auf der Welt viele Menschen, mächtige Menschen, die die Kolonie finden und zerstören wollen.«
»Ich will Ihnen gerne helfen, wenn ich das kann.«
»Dazu muss ich mehr über Sie wissen. Ángel sagt, dass Sie in Deutschland empathische und vielleicht sogar telepathische Anlagen besaßen. Allerdings standen Sie damals auch unter dem Einfluss eines starken Medikaments, das Ihre Fähigkeiten verstärkt oder sogar erst verursacht hat. Darum ist meine Frage: Was können Sie jetzt noch, nachdem Sie wieder clean sind?«
»Angelo sagt, die Droge hat mich beinahe umgebracht.«
Paolo konnte den Namen mittlerweile ebensogut aussprechen wie ein Spanier. Dennoch hielt er an Angelo fest. Ángel war einverstanden gewesen, von ihm so genannt zu werden, als sie sich kennengelernt hatten und Paolo war sich sicher: Es gefiel ihm sogar.
»Er hat recht. Ihr Leben hing zwischendurch an einem seidenen Faden und wir hätten Sie beinahe verloren.«
»Angelo hat mir verboten, jemanden hier länger zu berühren. Auf diese Art habe ich früher Verbindung zu anderen Menschen aufgenommen. Deswegen kann ich Ihre Frage nur zum Teil beantworten. Ganz verschwunden ist meine Gabe auf jeden Fall nicht. Ich spüre die Gegenwart anderer Leute, wenn ich ihnen nahe genug bin, und kann ihre Gefühlslage grob einschätzen. Bei Ihnen spüre ich vor allem Einsamkeit. Trauer und Einsamkeit. Sie haben kürzlich jemanden verloren. Um mehr zu spüren, müsste ich Sie berühren. Darf ich …?«
»Das kommt nicht in Frage!« Paolo spürte ihr Zurückweichen geradezu körperlich.
»Ihre Auskunft genügt mir.« Ihr scharfer Blick ging zu Ángel. »Haben Sie ihm etwas über mich erzählt? Irgendetwas?«
»Nein.«
»Okay.« Sie wandte sich wieder Paolo zu: »Es fällt mir schwer, zu glauben, dass Sie das können, aber derzeit habe ich keine bessere Erklärung. Ángel sagte, dass Ihre Fähigkeit auch auf größere Distanz wirkt?«
»Damals stand ich noch unter dem Einfluss der Droge. Momentan reicht sie einige Meter weit. Maximal. Ich weiß mehr, wenn ich wieder jemanden berühren darf.«
»Ich verstehe. Dann müssen wir jemanden finden, den Sie berühren können, ohne das Risiko, dass er einen Schock fürs Leben bekommt.«
Paolo sagte nicht, dass er die Stille um sich herum sehr erholsam fand. Früher, als seine Fähigkeiten durch die Droge verstärkt worden waren, war es ihm schwer gefallen, sich selbst von der Menge zu isolieren, wenn er sich unter Menschen befunden hatte. Die Gedanken und Gefühle der anderen bildeten ein Netz um ihn herum, in dem er sich regelmäßig mit seinen eigenen Gedanken verfangen hatte und das ihn enorm angestrengt hatte. Jetzt ging das alles viel einfacher.
»Ich mache es«, sagte Ángel. »Ich weiß, worauf ich mich einlasse, denn du hast mich bereits berührt. Versprich mir nur, dass du vorsichtig bist. Ich möchte nicht Maricón werden.«
»Ich verspreche es«, sagte Paolo leise. Fast wirkte er in diesem Augenblick schuldbewußt.
»Er könnte Männer umpolen?«, fragte Klotho ungläubig.
»Ich habe es gesehen.«
Paolo stand auf und trat auf Ángel zu. »Gib mir deine Hand«, bat er ihn. Der streckte sie zögernd aus. Die beiden anderen sahen, dass der breite, starke Mann sich dazu überwinden musste und verkrampfte. Sie legten vorsichtig die Hände ineinander. Es dauerte einige Sekunden, dann nahmen sie die Hände wieder auseinander und sie sahen Ángel die Erleichterung an.
»Es ist okay«, sagte er. »Ich spüre zwar etwas, es fühlt sich freundlich an, nein es ist Freundschaft. Kommt das von dir?«
»Ja, das bin ich. Ich mag dich. Nicht sexuell«, fügte er zur Sicherheit hinzu. »Ich spüre deine Gefühle jetzt intensiver als vorher. Ich glaube, ich sollte sie aber nicht benennen. Es war ein Fehler, dass ich das vorhin getan habe«, sagte er mit plötzlicher Erkenntnis zu Klotho. »Es tut mir leid.«
»Es ist in Ordnung. Ich hatte Sie darum gebeten. Ich war nur nicht darauf vorbereitet, dass Sie das wirklich können, was man über Sie sagt.«
»Wenn Sie wissen wollen, wie stark meine Gabe ohne die Droge noch ist, bringen Sie mir einen Mann, mit dem ich Sex haben kann.« Er sah, wie Klotho die Augen erstaunt aufriss und fügte schnell hinzu: »Dazu habe ich damals die Droge erhalten. Ich habe als Escort gearbeitet und viel Geld für meinen Boss verdient.«
Klotho warf einen durchdringenden Blick auf Ángel. »Mir scheint, ich habe über das damalige Projekt noch nicht alles erfahren. Holen Sie das bitte bis morgen nach.«
»Selbstverständlich«, beeilte sich Ángel zu versichern.
Kapitel 5. Mike (05.03.2018)
Sie schliefen aneinander gekuschelt in ihrem Bett in Maurices Wohnung. Mike erwachte, als er so etwas wie ein Räuspern hörte.
Als er sich schlaftrunken aufrichtete, erschrak er sehr, weil eine dunkle Gestalt auf seiner Bettkante saß. Mike stupste Maurice an. Der ließ aber nur ein leises Brummen hören und wälzte sich auf die andere Seite. Als Mike die Nachttischlampe anschaltete, erkannte er den Schatten auf der Bettkante.
»Walter!«
Professor Walter Stein trug dieselben Sachen wie an jenem Abend, an dem sie sich zuletzt gesehen hatten. Der Abend, bevor er Paris verlassen hatte, um in der Anlage seiner Freundin Klotho Papantoniou im chilenischen Hochland seine letzten Wochen zu verleben.
»Um Gottes Willen, haben Sie mich erschreckt. Augenblick, Sie sind doch tot! Das verstehe ich nicht.«
»Nur weil wir etwas nicht verstehen, bedeutet es nicht, dass es göttlich ist. Es bedeutet nur, dass wir es nicht verstehen.«
Mike beugte sich zu Maurice und rüttelte ihn an der Schulter.
»Das ist zwecklos. Er wird nicht aufwachen. Und selbst, wenn Sie es schaffen, könnte er mich nicht sehen. Ich existiere nur in dem Traum, den Sie gerade träumen.«
»Ich träume? Aber das fühlt sich alles so real an!«
»Das tun Träume manchmal. Ich kenne diese Erfahrung bereits. Für Sie ist es heute das erste Mal.«
»Wenn ich träume, dann müsste doch … Moment.«
Mike drehte sich um und sah auf den Radiowecker, der auf Maurices Nachttisch auf der anderen Seite des Bettes stand. 02:30 Uhr. Dann blickte er wieder auf Walter. Der saß noch da. Dann sah er wieder auf die Uhr: immer noch 02:30 Uhr. Nein, gerade sprang die letzte Ziffer um: 02:31 Uhr. Er nahm das Buch von seinem eigenen Nachttisch. ‘Die Tyrannei des Schmetterlings’. In diesem Buch hatte er vor dem Einschlafen gelesen.
»Das ist kein Traum«, stellte er dann fest.
»Bevor ich erkläre, was Sie gerade erleben, würde ich vorschlagen, dass wir uns von nun an duzen.« Mike nickte zögernd. »Du warst im letzten Jahr mein engster Freund. Nur für Klotho habe ich noch mehr empfunden, aber das … ist kompliziert. Momentan hältst du mich sowieso nur für eine Ausgeburt deiner Fantasie, daher: Was macht es schon?«
Mikes Verwirrung stieg mit jeder Sekunde. Das konnte kein Traum sein, denn die Buchstaben und Ziffern des Weckers änderten sich nicht willkürlich, wenn er sie ein weiteres Mal betrachtete. Andererseits sprach er gerade mit jemandem, der vor knapp zwei Wochen gestorben war. Dass Walter ihn dabei anlächelte wie ein Grundschullehrer, der einem zurückgebliebenen Schüler etwas Grundlegendes erklärte, machte die Situation nicht besser.
»Wer bist du? Anders gefragt: Was bist du?«
Die Anzeige des Weckers auf Mikes Nachttisch sprang auf 02:32 Uhr.
»Ich bin der Walter Stein, den du aus deinen Erinnerungen kennst. Meinen Aufzug musst du entschuldigen. Ich trage nur das, was du mir anziehst. Du bist ja auch nicht angemessen gekleidet.«
Mike blickte an sich herunter. Dann fiel ihm ein, dass er ja immer nackt schlief und er zog im Reflex die Decke etwas höher. Walters Lächeln verwandelte sich in ein heiteres Grinsen, als er das sah.
»Keine Sorge, selbst ich weiß, wie ein anderer Mann aussieht. Ich entdecke an dir nichts Neues.«
»Und wenn… du hättest dich vorher anmelden müssen. Dann hätte ich einen Schlafanzug übergezogen. Wobei dann Maurice dumm geguckt hätte.«
»Du willst wissen, warum ich hier bin.«
»Vermutlich nicht, um einfach mal ungezwungen über alte Zeiten zu plaudern.«
Mike überlegte, ob es sich bei Walters Erscheinung um eine neue Variation seiner Tagträume handelte, verwarf diesen Ansatz aber wieder.
»Leider nein. Ich wünschte mir, es wäre anders. Weißt du, vor beinahe einem Jahr habe ich dieselbe Frage an Martin O’Connor gestellt.«
Mike hob die Brauen. »Aber der war doch da schon lange tot!«
»Genau. So wie ich jetzt. Aber er spukte durch meine Träume und er wusste Dinge, die er nicht wissen konnte. Er hat es mir damals erklärt.«
»Was? Dass es ein Leben nach dem Tode gibt?«
»So einfach ist es nicht. Wir leben weiter in den Erinnerungen der Leute, die uns geliebt haben. Seit diese Dimensionspforte im CERN aber geöffnet ist und die andere … aber das tut jetzt nichts zur Sache … Seither können wir unter bestimmten Umständen zu diesen Menschen Kontakt aufnehmen. Bei mir sind es leider nur zwei: Klotho und du.«
»Was für Umstände?«
»Ich habe versucht, mit Klotho so zu reden, wie ich es jetzt mit dir tue. Leider ist ihr Geist nicht so offen wie deiner. Sie verleugnet mich.«
»Ich habe Klotho als harte Führungspersönlichkeit erlebt. Eines ist sie aber nicht: flexibel. Vielleicht verfährt sie nach der Devise, dass nicht sein kann, was nicht sein darf. Vielleicht ist ihre Trauer auch einfach zu stark. Gib ihr Zeit.«
»Das kann ich leider nicht. Ihr werdet bald vor einer großen Herausforderung stehen. Ihr würdet sie auch ohne meine Hilfe meistern, aber die Möglichkeit, wenigstens einen von euch erreichen zu können, gibt mir das Gefühl, auf meine alten Tage noch etwas bewirken zu können.«
»Du sprichst in Rätseln, aber das ist ja nichts Neues.«
»Wenn du morgen früh aufwachst, wirst du alles zunächst für einen Traum halten. Du wirst es Maurice erzählen. Er wird dir sagen, du hättest beim Abendessen keine zwei Nachschläge nehmen sollen. Weißt du übrigens, dass es sich total süß anhört, wenn er schnarcht?«
Mike schaute ungläubig auf sein Gegenüber. »Du siehst aus wie Walter, aber du verhältst dich nicht wie er.«
»Das scheint eine Nebenwirkung meines jetzigen Zustandes zu sein. Ich bin der Walter, der ich hätte sein können, wenn ich mir nicht zeitlebens selbst Beschränkungen auferlegt hätte. Martin O’Connor verhielt sich mir gegenüber auch wesentlich offener, als ich ihn in Erinnerung hatte.«
»Muß ich jetzt etwa damit rechnen, dass du dich für den Rest meines Lebens durch meine Träume plauderst? Wie soll ich dann zur Ruhe kommen?«
Mike begann, dieses Erlebnis mit anderen Augen zu sehen. Die Unterhaltung war skurril, aber verdammt noch mal, sie machte auch Spaß.
»Keine Sorge. Heute besuche ich dich nur, um sicherzustellen, dass du mir zuhörst, wenn es so weit ist.«
»Wenn was wie weit ist? Du hast wohl mit dem Orakel von Delphi zu Abend gegessen.«
»Gib es zu: Dafür magst du mich doch!« Walter kicherte unbeherrscht, etwas, das Mike noch nie bei ihm gesehen hatte und das deswegen nicht zu seiner Beruhigung beitrug. »Aber im Ernst: du bist noch nicht bereit, mir zu glauben. Alles hat seine Zeit.«
»Wenn du das sagst …«
»Schlaf dich jetzt erst mal aus. Morgen hast du einen anstrengenden Tag vor dir. Es gibt Ärger in der Redaktion.«
Walter erhob sich und löste sich in einer Nebelwolke auf. Mike legte sich kopfschüttelnd wieder zurück in die Kissen und schlief den Rest der Nacht traumlos.
Am nächsten Morgen konnte er sich an den Traum in allen Einzelheiten erinnern, etwas, das ihm sonst selten passierte. Beim gemeinsamen Frühstück erzählte er Maurice davon.
»Ich bin froh, dass ich nicht mehr träume«, sagte der und setzte seinen Kaffeebecher ab. »Als wir zwei uns kennengelernt haben, haben mich meine Träume ziemlich genervt.«
»Ich erinnere mich. Einmal hast du mir deswegen ja sogar die Freundschaft gekündigt. Mich irritiert nur, wie realistisch der Traum sich angefühlt hat. Ich hätte schwören können, dass ich wach bin.«
»Vielleicht hättste gestern Abend nicht zweimal Nachschlag nehmen sollen.«
Kapitel 6. Oleg (06.03.2018)
Nur einen Tag, nachdem der Alte gestorben war, begannen die Arbeiter, auf einem Friedhof im Norden von Krasnoyarsk mit Pressluftbohrern das Grab in den noch vom Winter gefrorenen Boden zu stemmen. Oleg verlor keine Zeit. Es hätte nicht dem Willen seines Großvaters entsprochen, alles mit wochenlanger Trauer lahmzulegen. Er achtete seine Religion, aber auf eine pragmatische Art. So plante Oleg die orthodoxen Begräbniszeremonien so kurz wie möglich und lud nur den engsten Familienkreis dazu ein.
Für einen Oligarchen verhielt er sich damit sehr ungewöhnlich. Üblicherweise nutzte die gesamte Führungsebene eine Trauerfeier zur Selbstdarstellung. Bei der Größe des Konsortiums hätte Oleg damit mühelos ein Fußballstadion füllen können. Dass er das unterließ, sorgte allseits für Verwunderung, hatte für ihn aber den Vorteil, dass er lediglich seinen eigenen Sicherheitsdienst zur Absicherung der Veranstaltung einsetzen musste. Die Wachleute standen zwischen den umstehenden Büschen postiert und wirkten so unauffällig wie eine Nonne als Schiedsrichterin eines Fußballspiels.
Er würde dafür in den kommenden Monaten auf die eine oder andere Art geradestehen müssen, dass er das Begräbnis und vor allem die anschließende Trauerfeier privat hielt. Alles konnte er dennoch nicht abbügeln. Seine Mutter und seine Tante bestanden darauf, dass wenigstens eine Rede zu Ehren des Toten gehalten wurde. Sie hatten dafür extra einen Redenschreiber und einen Trauerredner engagiert, damit alles der gesellschaftlichen Bedeutung des Verstorbenen gerecht wurde.
Nach dem Ende der Gebets- und Weihrauchzeremonie dauerte diese Rede nochmals eine gefühlte Ewigkeit. Die ganze Familie stand um die Grabstelle herum versammelt. Nach einer Viertelstunde setzte Schneeregen ein. Ungeduldig trat Oleg von einem Fuß auf den anderen. Nahm diese Ansprache denn gar kein Ende? Mit einer fahrigen Bewegung nahm er ein angeweichtes Stück Brot vom Tisch, auf dem der Begräbnisschmaus stand, und schluckte es angewidert hinunter.
Langsam wurde nun der glänzend lackierte Sarg an Seilen in die Grube gelassen. Oleg beobachtete den Vorgang genau, denn die vier Träger hatten bereits beim Auszug aus der Kapelle etwas überfordert gewirkt mit der massiven Eiche. Der Priester goss anschließend den Inhalt einer Flasche Weins kreuzförmig über den Sarg. Um ein Haar hätte er dabei auf dem glitschigen Boden das Gleichgewicht verloren und wäre selbst in die Grube gefallen.
Dann – endlich – endete die Veranstaltung mit einem letzten Segen und die Trauergäste marschierten geschlossen in Richtung des Hauptweges, der zum Ausgang führte.
Nur Oleg schlug seinen Mantelkragen hoch, blies seine Kerze aus, legte sie achtlos auf einen Grabstein in der Nähe und bog danach auf einen schmalen Weg ab, der zu einem Nebenausgang führte. Dort wartete bereits sein Wagen und er konnte ungesehen von hier verschwinden.
»Sie müssen sich das nicht antun.« Mit diesen Worten wurde unerwartet ein Golfschirm über ihm aufgespannt. Oleg drehte sich um und erblickte ein Gesicht, das ihm flüchtig bekannt erschien. Er musste kurz nachdenken, um ihn zuordnen zu können.
»Was macht schon ein bisschen Regen?«, fragte er dann. »Sie sind Pjotr Maksimow?«
»Genau. Wir kennen uns aus den Videokonferenzen Ihres werten Großvaters, denen Sie beiwohnen durften. Ich bin der Sektionschef für Europa. Ich spreche Ihnen mein tief empfundenes Beileid aus. Als ich hörte, was geschehen ist, habe ich mich sofort in den nächsten Flieger gesetzt.«
»Danke.«
Oleg missachtete die ausgestreckte Hand und fragte sich, wie der Mann es an seinen Leuten vorbei auf die private Familienfeier geschafft hatte.
»Wir haben uns übrigens bereits während Ihres Studiums in Cambridge kennengelernt. Sie haben einige meiner Kurse besucht. Mittlerweile finde ich dafür leider keine Zeit mehr, weil die Leitung meiner Unternehmen und die Arbeit für das Konsortium mich völlig auslasten.«
»Nehmen Sie es mir nicht übel, aber das ist lange her. Ich erinnere mich nicht.«
Oleg versuchte, möglichst abweisend zu klingen, denn das Gespräch empfand er zum jetzigen Zeitpunkt als anstrengend.
»Das macht doch nichts!« Unglücklicherweise kam seine Botschaft nicht an. »Wir können in den nächsten Monaten sicher unsere alte Freundschaft wiederauffrischen. Sie benötigen meine Hilfe bei der Leitung des Konsortiums und ich habe eine Reihe von profitablen Ideen, die ich Ihnen vorstellen möchte.«
»Hat das nicht Zeit? Heute ist ein Tag der Trauer und des Gedenkens.«
»Ihr Großvater hätte das möglicherweise anders gesehen.«
Besass dieser Mensch denn gar kein Feingefühl? Dann musste er auch keines zeigen.
»Möglicherweise hätte er das«, erwiderte er darum schroff. »Lassen Sie sich in der nächsten Woche von meiner Assistentin einen Termin geben. Dann können wir über alles reden. Wenn Sie mich jetzt entschuldigen würden.«
Oleg ließ seinen Gesprächspartner stehen und eilte zum Seitenausgang. Im Geiste fügte er einen neuen Punkt zu seiner Agenda für die nächsten Wochen hinzu: Informationen über die anderen Entscheidungsträger im Konsortium einholen. Er hätte das schon vor Monaten tun müssen, sobald sich die Entwicklung abgezeichnet hatte. Insbesondere Maksimow würde er genau unter die Lupe nehmen müssen.
Er verließ den Friedhof. Vor den Seitenausgang stand wie besprochen seine Limousine. Ein Mitarbeiter öffnete ihm die Tür und er stieg ein.
»Zum Landeplatz«, wies er den Fahrer an. »Geben Sie Bescheid, dass der NH90 startklar gemacht wird.«
Er schrieb eine Nachricht an den Inhaber des Restaurants, zu dem der Rest seiner Familie unterwegs war und bat darum, ihn mit unaufschiebbaren, dringenden Geschäften zu entschuldigen. Das bevorstehende familiäre Beisammensein würde ohne ihn stattfinden. Zu viele Familienmitglieder ertränkten regelmäßig ihren Kummer – ob echt oder vorgetäuscht – in Vodka.
Einem guten Wein oder auch einem Obstler war er nicht abgeneigt, aber diese Gelage ekelten ihn an, seit ihn einer seiner Onkel auf einer Familienfeier mit Vodka abgefüllt hatte. Nach dem ersten Glas hatte er sich großartig und sehr erwachsen gefühlt. Nach mehreren weiteren Gläsern hatte aber seine Erinnerung ausgesetzt und er bekam auch später nicht mehr zusammen, was an jenem Abend geschehen war. Erst am nächsten Tag war er wieder zu sich gekommen und hatte es gerade noch bis ins Bad geschafft, ehe er sich übergab.
Seine Mutter hielt ihm als Erstes eine Standpauke. Danach fragte sie ihn aus. Als Nächstes hielt sie seinem Vater eine Standpauke. Die lauten Stimmen drohten, seinen Kopf zum Platzen zu bringen. Es ging ihm tagelang so schlecht, dass er sich zunächst schwor, im Leben nie wieder einen Tropfen Alkohol anzurühren.
Ganz so genau nahm er seinen Schwur später dann nicht mehr, aber er wusste seitdem präzise, wann er mit Trinken aufhören musste.
Nur Vodka rührte er nie wieder an, auch wenn ihm das gelegentlich mitleidige Blicke von Freunden eintrug. Zu seinem Großvater hielt er seit diesem Erlebnis eine gewisse Distanz. Er respektierte, dass dieser ihn liebte und nach Kräften förderte. Dass er an jenem Abend aber mit in der Runde gesessen hatte und nicht eingeschritten war, das vergaß er ihm nicht.
Sie erreichten den Landeplatz in einem separat zugänglichen Außenbereich des Flughafens und er stieg in den Hubschrauber, der kurz darauf abhob. Da er von Anfang an vorhatte, gleich wieder zurückzufliegen, reiste er ohne Gepäck. In Novaya Kalami fühlte er sich viel mehr zu Hause als in Krasnoyarsk. Außerdem lag sein Herzensprojekt dort gleich vor der Haustür.
Offiziell gab es an dieser Stelle nur eine Goldmine, die größte Russlands, deren Krater die Landschaft auf dutzende von Quadratkilometern verschandelten. Der wahre Schatz lag im Untergrund, sicher verborgen vor neugierigen Satellitenaugen: Ein Teilchenbeschleuniger, dessen Leistungsfähigkeit die des LHC am CERN deutlich in den Schatten stellte.
Angefangen hatte es alles mit dem Prototypen eines Fusionskraftwerkes, das sein Großvater dort hatte in den Zweitausendern errichten lassen. Unglücklicherweise hielt die technische Entwicklung mit den hochfliegenden Plänen des Alten nicht Schritt und der Beschleuniger, der das Kernstück des Kraftwerkes bilden sollte, ruhte viele Jahre beinahe ungenutzt im Boden der Taiga.
Erst in den letzten Jahren war die Anlage dank Olegs Initiative wieder instandgesetzt, grundlegend renoviert und auf den neuesten Stand der Technik gebracht worden. Die Neuigkeiten von den Geschehnissen am CERN lenkten das Projekt dann aber in eine neue Richtung. Sie fielen genau in Olegs Fachgebiet und lösten einen kreativen Schub bei ihm aus. Binnen weniger Monate entwickelte er eine eigene Theorie der dahinterstehenden Physik, die mit den Überlegungen von Walter Stein bis auf wenige Details völlig übereinstimmte.
Oleg interessierten an dieser Entwicklung allerdings vorrangig die praktischen Einsatzfelder. Schon bevor sein Großvater im Geheimen Antimaterie aus der Dimensionspforte im CERN extrahieren ließ und von einer Bombe träumte, arbeitete er bereits an der Konstruktion einer neuartigen Anlage zur Energieerzeugung, die den Beschleuniger mit Strom versorgen sollte. Ein Bauwerk, das man aus Sicherheitsgründen nicht in besiedelten Gebieten errichten konnte, denn der Brennstoff, mit dem es lief, zerstrahlte beim bloßen Zusammentreffen mit herkömmlichen Stoffen zu gewaltigen Mengen reiner Energie und mußte daher besonders abgeschirmt werden.
Seit einer Woche lief das Kraftwerk bereits mit der Antimaterie, die sie im vergangenen Jahr in der Schweiz abgezweigt hatten, und gestern hatten sie den Beschleuniger zum ersten Mal auf volle Leistung hochgefahren. Falls seine Berechnungen stimmten und bisher hatten sie das immer, dann musste sich heute eine neue Pforte öffnen.
Sie befanden sich noch im Anflug auf Novaya Kalami, da flutete eisige Kälte unvermittelt seinen Körper und ihm standen überall die Haare zu Berge. Sein Magen revoltierte und er schmeckte im Mund den säuerlichen Geschmack halb verdauten Brotes. Ein intensives Déjà-vu manifestierte sich in seinem Denken. Wann und wo hatte er das schon einmal erlebt?
Dann fiel es ihm ein: Es war im letzten Jahr in Genf gewesen. Damals hatte er mit einer Delegation russischer Wissenschaftler die Anlage des CERN besucht und auch die Kaverne, in der sich das ATLAS Experiment befand, besichtigt. Nur wenige Leute wussten damals von der Dimensionspforte und außer dem Institutsleiter hatte nur er Kenntnis davon, dass sie zu dieser Zeit vom Konsortium zur Gewinnung von Antimaterie genutzt wurde. Dort war ihm ebenfalls eine seltsame, atmosphärische Spannung aufgefallen, die in der Maschinenhalle geherrscht hatte. Außer ihm schien sie niemand registriert zu haben. Sie war nicht so intensiv gewesen wie jetzt, aber … sollte etwa …?
Er reagierte sofort und zog sein Smartphone. »Geht es los?«, fragte er als Erstes, nachdem die Verbindung stand.
»Moment, ich sehe nach. Oh, es scheint, als wären die Detektoren gestört. Ich werde mich darum kümmern.«
»Die Detektoren sind in Ordnung. Starten Sie sofort Programm Tsarítsa 1!«
Bei diesem Programm handelte es sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme. Er hatte den schweren Unfall beim ersten Öffnen der Anomalie in Genf bereits ins Kalkül gezogen und einen Umkreis von fünfzig Metern um die Stelle, an der sich die neue Pforte bilden sollte, so geplant, dass dort niemand vor Ort sein musste, und außerhalb von Wartungsarbeiten alles automatisch erledigt werden konnte.
Jetzt wurde dieser Bereich noch einmal erweitert, alle Mitarbeiter in das oberirdische Kontrollzentrum evakuiert und der Beschleuniger heruntergefahren.
Minuten später landete der Hubschrauber. Oleg sprintete über das kleine Flugfeld auf den Eingangsbereich zu. Aus der Luft konnte man diesen nicht erkennen, denn er befand sich tief unter einem Überhang. Niemand hätte hier mehr erwartet als einen der Sondierungsstollen, wie sie regelmäßig in den Untergrund getrieben wurden. Niemand konnte ahnen, dass dahinter Kernforschung auf einem Niveau betrieben wurde, das die Kollegen in Genf und Batavia hätte vor Neid erblassen lassen.
Kurz darauf betrat er das Kontrollzentrum. Während ihn der Leiter der Nachmittagsschicht auf den neuesten Stand brachte, standen sie vor einer Monitorwand, die zeigte, was unten in der Halle vorging. Wie am Beschleuniger in Genf gab es auch hier einen Wald von Detektoren, der sich um eine Stelle des Beschleunigerrings gruppierte. In der Mitte dieses Arrangements ließ sich eine massive zylindrische Form erahnen, die allein einige Dutzend Meter Durchmesser besaß.
Stefano Magnone, der neue Institutsleiter des CERN, hätte sie vermutlich als eine stark vergrößerte Version der Black Box identifiziert, mit der das Konsortium dort im vergangenen Jahr Antimaterie gewonnen hatte.
Derzeit zeigten die Monitore nur eine Außenansicht des Geräteparks.
»Hat sich in der Kammer schon etwas ereignet? Wie weit sind wir?«
»Sie hatten völlig recht. Bereits kurz vor Ihrer Warnung fingen die Detektoren an, verrückt zu spielen. Die meisten maßen plötzlich überhaupt nichts mehr, obwohl der Protonenstrahl auf dem Target bis dahin jede Menge Kollisionen produziert hatte. Kurz darauf maßen wir die ersten Zerfälle von Antimaterie, hauptsächlich Wasserstoff und Helium. Wie Sie vorhergesagt haben, nahmen sie für eine Zeit exponentiell zu. Dann flachte die Kurve aber schnell ab, so dass es nicht zu einer Antimaterieexplosion mit dem Target kam. Seitdem scheint sich eine Art Gleichgewicht eingestellt zu haben. Die Zerfälle befinden sich auf hohem Niveau, aber weit unterhalb der Sicherheitsschwelle, für die die Anlage konzipiert wurde.«
»Okay. Dann wollen wir uns ansehen, was wir geschaffen haben. Entfernen Sie das Target und lassen Sie uns einen Blick in die Kammer werfen.«
Es dauerte einige Minuten, in denen das hauchdünne Metallplättchen langsam aus dem Strahlengang des Beschleunigers gezogen wurde. Als die Detektoren nur noch eine geringe Reststrahlung anzeigten, aktivierte sich die Innenkamera. Eine zentimeterdicke Abschirmung fuhr beiseite und ein Fenster auf der Monitorwand, das bisher schwarz gewesen war, zeigte jetzt das Innere der Black Box.
»Auf den ganzen Schirm!«, ordnete Oleg an. »Und die Beleuchtung herunterdimmen.«
Im hellen Schein der Lampen konnten sie zunächst nicht viel erkennen. Dann, als das Umgebungslicht im Raum fast erloschen war, zeichnete sich auf dem Bildschirm ein kreisrunder Bereich ab, der bläulich schimmerte und von einem silbernen Ring umgeben war, dessen Oberfläche sich in ständiger Bewegung zu befinden schien.
»Das ist mehr, als ich erwartet habe«, sagte Oleg beinahe ehrfürchtig.
»Der bläuliche Schimmer, ist das etwa Tscherenkow-Strahlung?«
»So sieht es aus. Wir blicken auf einen echten Ereignishorizont und wir werden die Wunder erforschen, die dahinter auf uns warten.«
Eine ganze Weile standen sie da. Oleg konnte sich nicht sattsehen an dieser Aufnahme, die im schwachen Licht zwar etwas unscharf und verrauscht aussah, aber für die Forschung ähnlich bahnbrechende Erkenntnisse produzieren konnte, wie es die ersten Nebelkammeraufnahmen von Antiteilchen in den dreißiger Jahren des letzten Jahrhunderts getan hatten.
»Die Aufnahme wirkt viel detaillierter, als ich erwartet habe. Wie hoch ist eigentlich der Vergrößerungsfaktor?«
Der Schichtleiter stotterte, als er antwortete: »Das … das ist … das ist keine Vergrößerung!«
von
Schlagwörter:
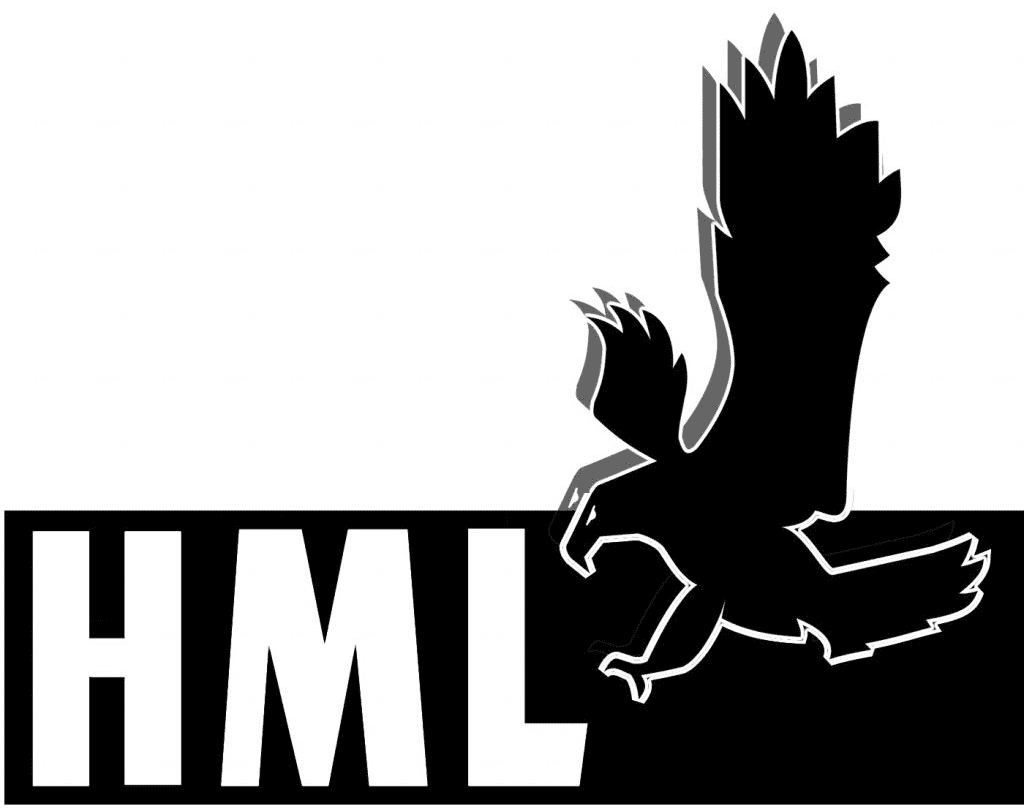

Kommentar verfassen