Dein Warenkorb ist gerade leer!
Leseprobe aus »Das Geheimnis der Untoten«
Prolog
Die Dunkelheit brach herein und ein kalter Wind wehte vom Land auf das Meer. Hier an der Westküste der Insel wirkte die Landschaft am unwirtlichsten. Schroffe Granitklippen fielen steil ab an einen Strand, der größtenteils aus Felsblöcken bestand. Die Uferlinie befand sich derzeit weit weg, denn es herrschte Ebbe.
Über viele hundert Meter fiel der Strand flach ab. Steine unterschiedlichster Größe stapelten sich wild durcheinander, bewachsen mit Muscheln und Tang. Ein rutschiger Untergrund, auf dem sich selbst bei Tageslicht schon mancher Tourist den Knöchel verstaucht hatte. Vereinzelt lagen Felsblöcke von gigantischen Ausmaßen herum. Einige von ihnen waren so hoch, daß sie auch bei Flut noch aus dem Wasser ragten und sich die Dünung an ihnen brach, die unablässig vom Atlantik in den Ärmelkanal hereinrollte.
Diese Dünung toste jetzt in einiger Entfernung. Dort traf Welle auf Welle die derzeitige Küstenlinie und entlud ihre Energie in spritzenden, weißen Schaumkronen an dem Felssockel, der seit hunderten Millionen Jahren im Untergrund der Landmasse gelegen hatte, die heute Bretagne heißt. Das Meer legte ihn Stück für Stück frei und setzte ihn der Kraft der Elemente aus, die seitdem unablässig an ihm nagten. In der Abenddämmerung wirkte es ein wenig, wie das ‘Land, das nicht sein darf’ aus dem bekannten Kinderbuch.
Jede einzelne Welle, die sich hier brach, führte zu keiner Veränderung, außer, daß eine Schar von Strandflöhen hektisch floh oder ein Krebs sich hinterher wieder in einer Spalte zwischen zwei Steinen verkroch. Dennoch – sobald es wieder Tag wurde und die nächste Ebbe die verborgene Landschaft erneut freilegte – fanden sich selbst große Felsblöcke auf wundersame Weise an andere Stellen versetzt. Fast, als hätten Riesen aus grauer Vorzeit damit Kegeln gespielt, sobald kein Menschenauge mehr auf dieser unwirklichen Szene ruhte.
Wenn ein Sturm über die Insel zog, was in ihrer exponierten Lage häufiger als anderswo der Fall war, veränderte sich sogar die Küstenlinie. Das weiche Wasser bewegte Steine, die so groß waren wie Kathedralen und Jahr für Jahr fraß es sich einige Zentimeter und manchmal auch einen ganzen Meter tiefer ins Land hinein.
Außer dem Geräusch der Brandung konnte der aufmerksame Lauscher hier draußen in den Pausen auch die Schreie der Möwen hören. Sie jagten zu dieser Tageszeit noch nach allem, was das Meer ihnen freiwillig oder unfreiwillig gab. Der Wind, der mal gleichmäßig stark und manchmal böig wehte, steuerte zur Geräuschkulisse ein Pusten und Zischen bei, solange nicht in der Höhe eine stürmische Böe vorüberzog, die für kurze Zeit mit ihrem Heulen alles übertönte.
Richtig aufdrehen konnte der Wind aber nur, sobald er eine aufnahmebereite Ohrmuschel zum Bespielen fand. Erwischte er sie im richtigen Winkel, so zuckten seine Opfer unter dem Ansturm dumpfen Brausens zusammen, das sich auf ihre Sinne legte und die restliche Welt für einige Sekunden ausblendete.
In der Nähe der Wasserlinie bildete eine Gruppe mittelhoher Felsen eine Art verbogenen Halbkreis, der die Szenerie zum Lande hin gegen neugierige Blicke abschirmte. Sie ragten schwarz auf vor dem Himmel, dessen helles Gelb zeigte, daß die Sonne soeben untergegangen war. Ihre Strahlen reichten nicht mehr bis auf den Boden, ließen aber einen Schwarm hoher Wolken, die im Zenit standen, in leuchtendem Orange strahlen.
Auf einmal mischte sich ein weiterer Ton unter die Geräusche der Umgebung. Es klang wie ein Hilferuf und kam aus dem Innern des Halbkreises. Dort lag ein Mann regungslos auf dem Boden. Sein Alter ließ sich in der Dämmerung nicht genau bestimmen, aber seine Stimme klang jung. Er bewegte seinen Kopf. Seine Arme und Beine lagen aber so schlaff da, als wären sie auf dem Boden festgebunden. Nach einer Weile hörte er auf zu rufen und lag ganz still da.
Seine Ruhe dauerte nur kurz, denn die Ebbe hatte ihren Tiefpunkt überschritten und das Wasser begann erneut zu steigen. Bald schon umspülte es die Füße des Mannes. Das löste einen neuerlichen Schub von Stöhnen und Rufen aus. Er schien sich wirklich nicht bewegen zu können, denn obwohl die Situation für ihn langsam gefährlich wurde, lag er hilflos im steigenden Wasser und außer seinem Stöhnen, das der Wind aufs Meer hinaustrug, war nichts mehr zu hören. Er hatte sich heiser geschrien.
Plötzlich materialisierte sich ein Schatten neben ihm. Er tauchte aus dem Nichts vor einem der Felsen auf und beugte sich über die am Boden liegende Gestalt. Übernatürlich war diese Erscheinung aber keineswegs, denn sie trug ganz profane Gummistiefel. Auch das nun folgende Gespräch drehte sich um eher weltliche Dinge.
»Gibst Du uns jetzt Deine Unterlagen? Das ist Deine letzte Chance.«
Der Schatten besaß eine männliche Stimme und ein leichter Beiklang in seinen französischen Worten verriet, daß er sich normalerweise auf bretonisch unterhielt.
»Werden sie mich dann hier herausholen?«
»Äh … ja. Wo befinden sich nun die Unterlagen?«
»Ich… ich… habe alles auf einem Stick gespeichert. Er befindet sich in meinem Haus. Ich habe ihn hinter den Fernseher im Wohnzimmer geklebt. Und jetzt helfen Sie mir hier heraus. Bitte!«
»In Ordnung. Ich komme wieder, sobald ich nachgesehen habe.« Die Gestalt wandte sich zum Gehen.
»Hey, halt! Bis dahin bin ich doch ertrunken! Bitte helfen Sie mir. Ich kann mich doch nicht bewegen!«
»Das war der Sinn der Aktion. Wir können Sie nicht freilassen. Jetzt nicht mehr. Können Sie sich das nicht denken?«
»Ich schwöre auf alles, was mir heilig… laufen Sie doch nicht weg! Lassen Sie mich hier nicht verrecken!«
Der Schatten mit den Gummistiefeln verschwand wieder hinter den Felsen und ließ den Mann allein. Mittlerweile lag sein Körper komplett im Wasser und er mußte den Kopf heben, damit die Wellen ihn nicht überspülten. Man hörte ihn für kurze Zeit leise vor sich hinweinen. Dann erhob er noch einmal seine Stimme.
»MÖRDER!« schrie er.
Dann begann er, heiser zu lachen. Nach Wahnsinn klang das. Nach Verzweiflung. Und Hohn.
Das Spiel der kleinen vor- und zurückplätschernden Wellen, die den Mann quälten, wurde von einer Reihe meterhoher Wellen abgelöst, die jetzt hereindrängten.
Kapitel 1. Ankunft
Die Enez-Vas legte weit draußen an der Rampe an. Eine Anzahl von Tagesbesuchern sprang aus der Fähre und eilte der Mole entgegen. Dort verteilten sie sich. Ein Grüppchen spazierte zügig an der Uferstraße entlang, um an deren Ende in eine kleine Straße einzubiegen, die einen Hügel hinaufführte. Dort stand eine alte, romanisch aussehende Kirche.
Angeführt wurde die Gruppe von einer resolut wirkenden Dame mit einem überdimensionalen Regenschirm, den sie trotzig in die steife Brise reckte. Die Kirche offenbarte sich erst auf den zweiten Blick als jüngeren Datums. Es gab zu viele Details, die nicht in die damalige Zeit paßten und auch der Erhaltungszustand war erheblich besser, als man es bei einer romanischen Kirche in dieser exponierten Lage erwarten konnte. Sehenswert mußte sie dennoch sein, denn die Dame mit dem Regenschirm begann einen längeren Vortrag.
Die restlichen Besucher verteilten sich auf die wenigen Restaurationen an der Mole und nach wenigen Minuten wirkte alles wieder, wie zu dem Zeitpunkt, bevor die Fähre angelegt hatte.
Springen wir jetzt noch einmal zurück an den Anfang und beobachten die Leute, wie sie die Fähre verlassen. Ganz zuletzt, als sich die meisten anderen Besucher bereits auf dem Weg zur Mole befanden, stiegen nämlich zwei Männer in den Dreißigern aus, denen man die Großstädter auf eine Seemeile gegen den Wind ansah.
Der eine war hochgewachsen, ohne schlaksig zu wirken. Sein Gesicht mit blaugrünen Augen strahlte einen jungenhaften Charme aus und den braunen Haarschopf hatte er am Morgen vielleicht einmal versucht, mit Gel in Form zu bringen. Nach einiger Zeit im frischen Wind der bretonischen Küste standen die Strähnen aber so wirr in alle Richtungen, daß sein Portrait für einen Augenblick an den Räuber Hotzenplotz erinnerte. Dann fielen aber der kurze, akkurat geschnittene Bart und sein freundlicher Blick ins Auge und die Assoziation verschwand so schnell, wie sie erschien.
Hinter sich her zog er einen überdimensionalen Rollkoffer, der ihm bis zur Hüfte reichte. Er mußte vollgepackt sein, denn auf der unebenen Betonrampe fiel ihm das Ziehen sichtlich schwer. Offensichtlich hatte er vor, etwas mehr Zeit auf der Insel zu verbringen.
Der andere Mann war kleiner und breiter gebaut. Unter seinem T-Shirt spannten sich wohldefinierte Muskeln. Ein tätowiertes Tribal wand sich um einen Oberarm und verschwand unter dem Ärmel des Shirts. Mit seiner dunklen Hautfarbe, den braunen Augen, der etwas zu langen Nase und den vollen Lippen würde es nicht befremden, ihn als Schauspieler in Filmen wie Casablanca zu sehen, oder in Uniform als Fremdenlegionär. Eine Narbe an der linken Schläfe verlieh ihm ein martialisches Aussehen und einige weitere Schrammen an Stirn und Jochbein waren erst frisch verheilt.
Ein mürrischer Zug um die Mundwinkel verstärkte den Eindruck, daß man sich mit diesem Mann besser nicht anlegte.
In dem Augenblick, als einer der Fährleute seine Sporttasche greifen wollte, um sie ihm nachzureichen, riß er sie mit einer raschen Bewegung an sich und bedachte den Mann mit einem so finsteren Blick, daß der in der Bewegung erstarrte. Ungelenk wuchtete er die Tasche auf den Boden. Um ein Haar wäre er dabei in den Spalt zwischen Boot und Rampe getreten. Erst in letzter Sekunde fing er sich und sprang mit einem für den Bewegungsablauf überraschend weiten Satz über die Tasche. Kopfschüttelnd wandte sich der verhinderte Helfer ab und hing die Sperrleine wieder vor den Durchgang.
Einige von euch kennen die beiden Männer schon. Es handelt sich um Mike Peters und Maurice Belloumi aus Paris. Sie haben im vergangenen Jahr eine Menge gemeinsam erlebt. Das hat sie zusammengeschweißt und sie sind enge Freunde geworden. Die Frage, ob sie ein Liebespaar seien, würden beide allerdings unterschiedlich beantworten. Mike mit einem gedehnten ‘ja’ und Maurice mit der knurrigen Feststellung, daß er nicht schwul sei. Er habe nur Sex mit Männern.
An der bretonischen Kanalküste ist der Tidenhub besonders hoch. Je nach Mondphase, Jahreszeit und Wetterlage kann er bis über fünfzehn Meter betragen. Hier auf der Île erreicht er im Frühjahr und Herbst immerhin zehn Meter. Damit ist ein Anleger im herkömmlichen Sinne nicht machbar. Die Bretonen haben dieses Problem auf eine pfiffige Weise gelöst: Sie bauen eine lange, flach abfallende Rampe in das Meer, an der die Fähren dort halten, wo sie gerade aus dem Wasser kommt. Bei Springebbe ist das weit draußen, bei normaler Ebbe oder bei auf- und ablaufendem Wasser entsprechend näher am Hafen. Nur bei Flut legt das Boot direkt an der Kaimauer an.
Jetzt stand das Wasser tief und Mike und Maurice mußten einen längeren Weg mit ihrem Gepäck absolvieren, ehe sie festes Land erreichten. Sie passierten ein Häuschen, in dem man die Tickets für die Überfahrt kaufen konnte und das einen kleinen Unterstand bot, in dem man bei schlechtem Wetter warten konnte. Dort sammelten sich aber regelmäßig nur die Touristen. Die Insulaner verschmähten ihn aus Prinzip.
Einen Unterstand brauchte man jetzt auch nicht. Die Sonne schien und das gesamte Hafenbecken lag trocken da. Die Schiffe der Fischer lagen bunt und scheinbar willkürlich verstreut auf dem steinigen Boden der Bucht. Bei einigen hatten die Besitzer besondere Ankerstangen im Boden verankert und sie daran festgemacht, damit sie aufrecht standen. Viele Boote lagen aber auch einfach lässig auf der Seite, als hätte sie ein Sturm oder die Faust eines Riesen dorthin gewürfelt. Die nächste Flut würde es schon wieder richten.
»Wir hätten vor der Abfahrt in Roscoff besser in den Tidenkalender gesehen, in einem Café am Hafen noch in Ruhe einen Espresso getrunken und ein oder zwei Boote später genommen«, kommentierte Mike die mißliche Situation.
»Stell Dich nicht so an!«
Maurice spuckte ihm die Worte vor die Füße. Sein Gegenüber entschloß sich, nicht gegenanzureden und zog seinen Koffer verdrossen hinter seinem Freund her, der ihm bereits einige Schritte voraus ging.
»Ich bin dafür, wir nehmen uns ein Taxi.« Mike wirkte erschöpft und der Fahrer des Inseltaxis öffnete ihnen bereits mit seinem breitesten Lächeln die Heckklappen seines Kleintransporters.
»Ich bin dafür, Du hältst die Klappe.« Maurice marschierte stumm mit seiner Tasche am Taxi vorbei und machte Anstalten, den Weg zu ihrer Unterkunft zu Fuß zu gehen.
»So machen wir uns hier keine Freunde.«
»Ich brauch keine Freunde.«
Er hielt nach einigen Metern dennoch an und kam betont langsam zurückgeschlendert. Mike wuchtete mit einem Seufzer der Erleichterung seinen Koffer in den Wagen und nahm auf dem Beifahrersitz Platz. Nach einigen Sekunden flog auch die Tasche in den Fond und Maurice rutschte hinter ihm auf die Sitze.
»Zur neuen Mühle bitte«, sagte Mike zu dem Fahrer, der ihn erwartungsvoll ansah. Dessen Gesicht zeigte Unverständnis.
»Zur neuen Mühle bitte!« Mike sprach betont langsam und deutlich, wie zu einem geistig Zurückgebliebenen.
»Pelec’h?«
Mike fühlte sich für einen Moment ziemlich hilflos. Es sah so aus, als könnte er sich auf französischem Boden nicht in Französisch verständigen. Da griff Maurice ein. Er knurrte einige Worte, die Mike nicht gleich verstand und schlagartig hellten sich die Züge ihres Fahrers auf.
»Ah, d’ar Milin Nevez. Laouen!« strahlte er Mike an, der jetzt genauso verständnislos guckte wie soeben der Fahrer. Das Auto setzte sich in Bewegung. Zuerst langsam, dann mit einer Beschleunigung, daß das Gepäck mit einem Schwung gegen die Türen flog und Mike dachte, sie müßten sich unter der Belastung öffnen. Am Ende der Mole bog der Wagen in Richtung Kirche ab, umschiffte lässig das Häufchen Touristen mit ihrer Stadtführerin und schlug dann, ohne zu bremsen, einen linken Haken.
Sie kannten die Strecke von ihrem letzten Besuch. Hier ging es zur Mairie, aber die ließen sie heute rechts liegen. Ihr Fahrer fuhr mit unvermindertem Tempo weiter durch die engen Straßen, bergauf und bergab, wich zwischendurch Treckern aus, die mit ähnlichem Tempo wie er durch die Straßen flitzten, und brachte es sogar fertig, im Vorbeifahren einige Worte mit Passanten zu wechseln. Mike erfuhr auf diese Weise, daß ihr Chauffeur Ivan hieß. Schließlich bog der auf eine Grünfläche ab, die unvermittelt hinter einer Häuserreihe erschien und bremste so scharf, daß Mike sich wünschte, er hätte den Sicherheitsgurt doch angelegt.
Vor ihnen lag zwischen zwei massiven Granitpfeilern ein breites Holztor, das schon bessere Zeiten gesehen hatte und nur mit einem Stück Wäscheleine dagegen gesichert war, daß es bei Sturm von selbst aufging. Daneben hing ein verwitterter Briefkasten, auf dem ‘Milin Nevez’ stand, was auf bretonisch ‘Neue Mühle’ bedeutet. Alte Koniferen bekränzten das Tor. Durch diesen Rahmen blickten sie auf ein Häuschen aus teilverputzten Granitsteinen, das auf einer kleinen Erhebung stand. Es lehnte sich an einen massiven Turm. Falls er einmal Windmühlenflügel getragen hatte, so sah man das jetzt nicht mehr. Man konnte das Ensemble auch für einen Neubau halten, so hell strahlte der Putz in der Sonne.
Ivan stieg aus, öffnete die Hecktüren und stellte Tasche und Koffer einfach ins Gras. »Douze!« sagte er zu Mike. Der gab ihm Fünfzehn und wurde mit einem Strahlen belohnt, als würde sich die Sonne in seinem Gesicht spiegeln. Wortlos stieg er in seinen Wagen und startete mit einer Beschleunigung, daß Erde und einige Grassoden durch die Gegend flogen.
»Was zur Hölle hast Du ihm gesagt?« fragte er seinen Freund, als sie ihr Gepäck zunächst aufs Grundstück gestellt hatten und um den Turm herumgingen. Auf der Rückseite des Gebäudes befand sich nämlich ein zweiter Eingang und dort sollte auch der Schlüssel hinterlegt sein.
»Daß ich dafür sorge, daß Yannik ihm morgen persönlich in den Arsch tritt, wenn er weiterhin so tut, als ob er nur Bretonisch kann.«
Mike war einen Moment sprachlos, entschloß sich dann aber, herzlich darüber zu lachen. »Okay, Freunde machen wir uns damit nicht, aber Respekt hast Du uns erkämpft.«
»Der ist mir zehnmal wichtiger.« Maurice deckte nacheinander die Jakobsmuscheln auf, die wie zu einem Hütchenspiel auf der Fensterbank neben der Türe lagen und tatsächlich befand sich unter der letzten ein kleines Schlüsselbund.
Yannik vertrat auf der Insel das Gesetz. Maurice hatte in den letzten Monaten mehrfach mit ihm in einer Mordsache zusammengearbeitet. Sie kamen gut miteinander zurecht und hatten den Fall erfolgreich abgeschlossen.
Wer unsere Helden noch nicht kennt: Maurice arbeitet bei der Pariser Mordkommission und Mike ist Redakteur beim ‘Magazine de la Science’, einer wissenschaftlichen Fachzeitschrift. Mike hat Maurice zweimal auf seinen Dienstausflügen während der Mordermittlung begleiten dürfen und die beiden haben beschlossen, auch einmal privat auf diese Insel zu fahren und sich gemeinsam zu erholen.
Das haben sie bitter nötig, denn die letzten Monate waren für beide sehr anstrengend. Schauen wir mal, wie gut es ihnen gelingt.
von
Schlagwörter:
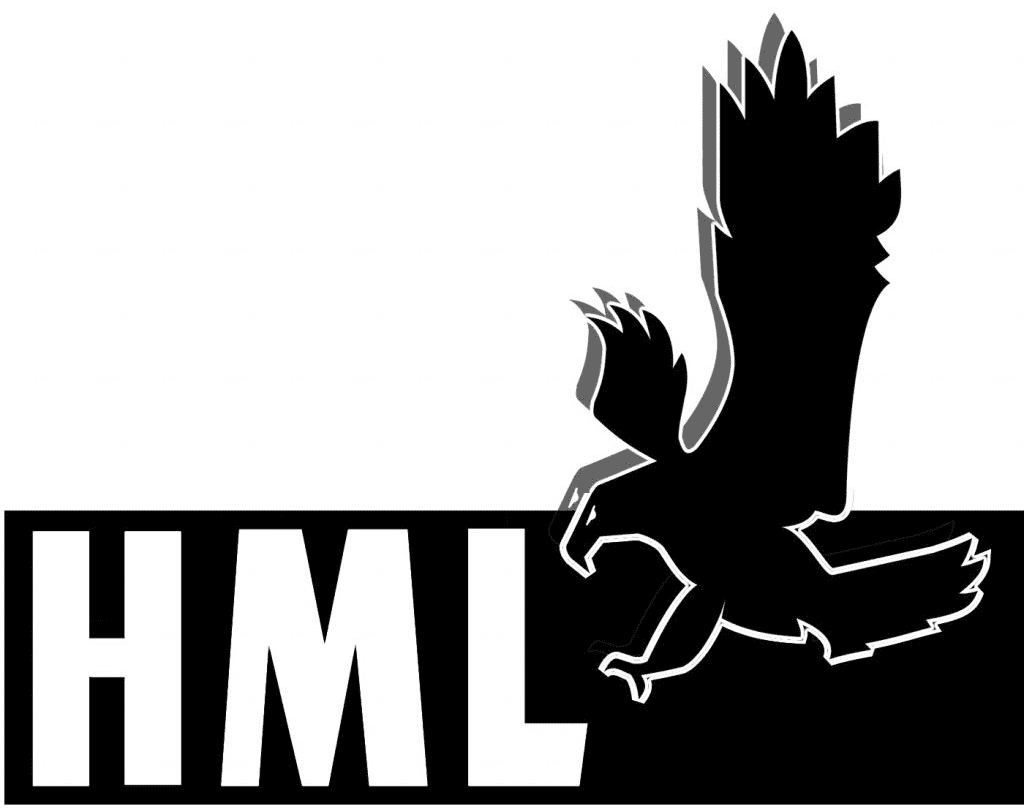


Kommentar verfassen